Lieferbare Bücher
Hier finden Sie Bücher aus dem VWB-Verlag, die wir hier schon eingepflegt haben. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir alle noch verfügbaren Titel hier einpflegen.
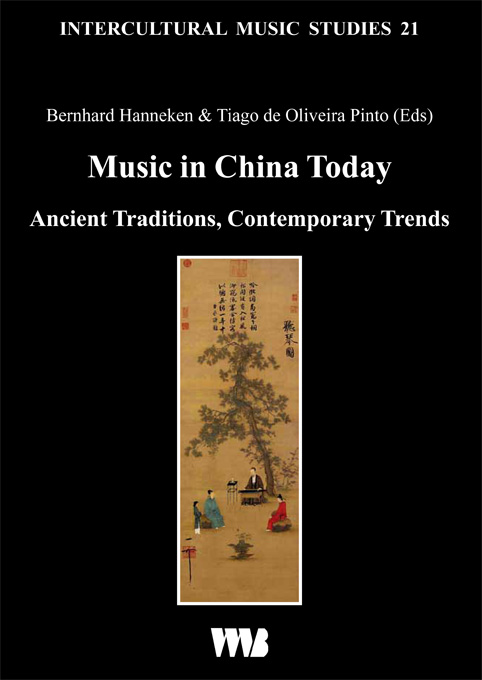
Music in China Today. Ancient Traditions, Contemporary Trends Bernhard Hanneken & Tiago de Oliveira Pinto (Eds) (Intercultural Music Studies Vol.: 21) 2017 256 pp. Book + 1 audio CD numerous Photographs Index engl. + Chinese abstracts 17 x 24 cm EUR 46,00 (UVP) ISBN 978-3-86135-652-3 Given China’s size and its long and varied cultural history with its many different cultural strands (not only from the 55 officially recognized minorities), it is surprising to see that comparatively little has been published in terms of ethno-musicological research. On the other hand, it needed UNESCO’s initiative of the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity to remind the Chinese of the values of their own traditions. China participated from the very beginning in the initiative—with success: As of November 2016, China has inscribed almost 30 different traditions into this list, plus another seven into a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding. Which has led to a surprising and radical change in the perception of traditional arts and crafts in China itself: All of a sudden they were in high regard again, becoming almost "fashionable pastimes for educated young people" (Helen Rees). This book looks at some of these traditions: at the changing tastes and attitudes towards the guqin zither and at a musical transfer at the end of the 18th century, at the minority music of the Naxi and Uyghur people, at developments in the 20th century such as Li Jinhui’s children operas in the 1920s or at the interdependence between music and power under and after Mao Zedong. Stepping into the 21st century, a new folk song movement and the careers and success of glittering girl bands are examined, as are the ways Chinese in Taiwan look at their old motherland. Two music-related themes are Chinese shadow play and the folk dance genre yangge, and last not least we also can read an advice for westeners how to open their ears for Chinese music. The book comes with an 80-minute audio CD whose 17 tracks give sound to the papers in this publication. Contents Preface ( Bernhard Hanneken & Tiago de Oliveira Pinto ) Helen Rees: Traditional Performing Arts in China Today: Cultural Policy and Practice Barbara Mittler: Of Pride and Prejudice. Rethinking Music and Power in China Alexander Rehding: From [²úªá to Moo-Lee-Chwa. History of a Musical Transfer ca. 1796 Omid Bügin: Representations of Guqin in China Today: From Recurrent Nostalgia, Cultural Etiquette to Revival Movements Frederick Lau: Celestial Music, Glamorous Angels: Girls Glitzing up Traditional Chinese Music Frank Kouwenhoven: Can Chinese Music Swing? NING Er: Soft Knife. China′s Folk Singer/Songwriters in the Last Decade TANG Lijiang: Chinese Shadow Play. Improvisation and Collaboration Johannes Sturm: The Rise and Fall of a Musical Genre: Li Jinhui′s Children Operas in the Context of Time Yongfei DU: Yangge: A Genre of Chinese Folk Dance Chuen-Fung WONG: Intercultural Encounters, Global Circulations, and the "Original Ecology" Style of Uyghur Music in the Late Twentieth Century and Beyond CHUNG Shefong: Who Is Singing Over Here? China as Ancestors′ Home and as a Foreign Land The Authors Content of CD Index
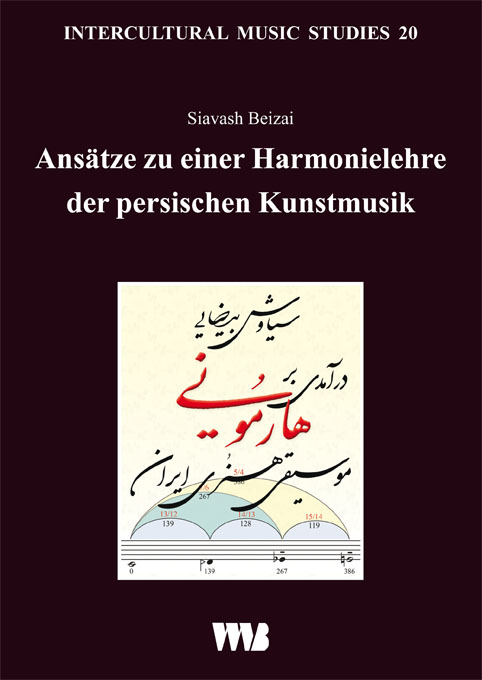
Ansätze zu einer Harmonielehre der persischen Kunstmusik Siavash Beizai (Intercultural Music Studies Vol.: 20) 2016 248 S. Buch + 1 CD zahlr. Notenbeispiele Index engl., pers. + dt. Zusammenfasung 17 x 24 cm EUR 42,00 ISBN 978-3-86135-651-6 Diese Publikation befasst sich zum ersten Mal mit der Geschichte, Theorie und Praxis der Mehrstimmigkeit der persischen Kunstmusik, in der seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch die ersten Kontakte mit der europääischen Musikkultur eine neue Epoche eingeleitet wurde. Es werden die Grundlagen und allgemeinen Regeln einer Harmonielehre der persischen Kunstmusik dargelegt, die großenteils aus Modi mit vierteltönigen Intervallen besteht. Die Intervalle, Akkorde, ihre Notationen und Terminologien, die modalen Strukturen und die wichtigen Aspekte des Tonsatzes werden ausführlich besprochen und durch konkrete Beispiele veranschaulicht. Anhand zahlreicher Noten- und Audiobeispiele sowie Analysen kann der Leser nicht nur das Modalsystem der persischen Musik kennen lernen, sondern auch die geschichtlichen Entwicklungsphasen der Mehrstimmigkeit der persischen Kunstmusik näher betrachten. Aus dem reichen Forschungs- und Erfahrungsschatz des Komponisten und Hochschullehrers Siavash Beizai heraus geschrieben, dient das Buch Musikwissenschaftlern, Komponisten, Musikstudenten und darüber hinaus auch Studenten, Musikern und Musikliebhabern als Referenz, Anregung und Wegweiser zur persischen Musik und ihrer Mehrstimmigkeit. (Zusammenfassung in deutscher, englischer und persischer >Sprache). Siavash Beizai, geb. 1953 im Iran, absolvierte sein umfangreiches Musikstudiumban der Hochschule für Musik Detmold (Komposition und Tonmeister), Folkwang-Hochschule Essen (Elektronische Komposition) und Wilhelms-Universität Würzburg (Promotion Musikwissenschaft). Er schlägt neue Wege in die Mehrstimmigkeit der persischen Musik ein und war u. a. jahrelang Dozent für Musiktheorie und Komposition an der Kunstuniversität und Hochschule für Musik in Teheran. Als Komponist und Autor sind von ihm bereits zahlreiche Werke ver&oouml;ffentlicht worden. Nähere Infos: www.siavash-beizai.com Inhalt Die wichtigsten Fachbegriffe der gegenwärtigen persischen Kunstmusik Vorwort I. Stand der Forschung und die Vorgeschichte der Mehrstimmigkeit der persischen Kunstmusik II. Notation der persischen Musik sowie charakteristische Intervalle und Akkorde 2.1 Zur Notation der persischen Musik 2.2 Charakteristische Intervalle der persischen Musik 2.3 Charakteristische Akkorde der persischen Musik III. Das Modalsystem der persischen Musik 3.1 Verschiedene Versionen des radif 3.2 Dastgah als Hauptmodus der persischen Kunstmusik 3.3 Avaz als untergeordneter Modus des dastgah 3.4 Guše, die melodisch-modale Einheit der radif 3.5 Die charakteristischen Eigenschaften der guše 3.5.1 Verschiede Arten der guše 3.5.2 Die Merkmale einer guše 3.6 Die dastgahs und avaze im Einzelnen 3.6.1 Dastgah-e mahur 3.6.2 Dastgah-e šur 3.6.3 Avaz-e abu‘ata 3.6.4 Avaz-e bayat-e tork (bayat-e zand) 3.6.5 Avaz-e afšari 3.6.6 Avaz-e dašti 3.6.7 Dastgah-e nava 3.6.8 Dastgah-e homayun 3.6.9 Avaz-e esfehan 3.6.10 Dastgah-e segah 3.6.11 Dastgah-e cahargah 3.6.12 Dastgah-e rast-panggah 3.7 Die vierteltönigen Intervalle der persischen Musik 3.8 Zur Größe der dreivierteltönigen Intervalle der persischen Musik 3.9 Die temperierten Vierteltöne und die 24-stufige Vierteltonleiter 3.10 Die neuen Möglichkeiten der Dreivierteltöne 3.11 Zur Konsonanz der dreivierteltönigen Intervalle und Akkorde 3.12 Die Leittöne der persischen Musik IV. Harmonielehre der persischen Kunstmusik 4.1 Zur Geschichte des harmonischen Denkens in der persischen Kunstmusik 4.2 Kontroverse Konzepte zur Praxis der Harmonisierung in der persischen Kunstmusik 4.3 Verschiedene Möglichkeiten, die persische Musik zu harmonisieren 4.4 Untersuchung der Harmonie in der traditionellen radif der persischen Kunstmusik 4.4.1 Dastgah-e mahur und rast-panggah 4.4.2 Dastgah-e šur und die verwandten avaze 4.4.3 Dastgah-e nava 4.4.4 Dastgah-e segah 4.4.5 Dastgah-e homayun 4.4.6 Avaz-e esfehan 4.4.7 Dastgah-e cahargah 4.5 Zu allgemeinen Regeln einer Harmonielehre der persischen Kunstmusik 4.5.1 Aufbau der Harmonielehre 4.5.2 Zur Stimmführung und Verdopplung der Töne 4.5.3 Die Grundakkorde der persischen Modi 4.6 Harmonisierungsmodelle der persischen Modi im Einzelnen 4.6.1 Dastgah-e mahur und rast-panggah 4.6.2 Dastgah-e šur und die verwandten avaze 4.6.2.1 Die Kadenzen des šur-Modus 4.6.2.2 Avaz-e abu‘ata 4.6.2.3 Avaz-e afšari 4.6.2.4 Avaz-e bayat-e tork 4.6.2.5 Avaz-e dašti 4.6.3 Dastgah-e nava 4.6.4 Dastgah-e homayun 4.6.5 Avaz-e esfehan 4.6.6 Dastgah-e cahargah 4.6.7 Dastgah-e segah V. Ansätze zu einer Harmonielehre der persischen Kunstmusik. Zusammenfassung Approches to the Harmony of Persian Art Music. Abstract VI. Liste der Hörbeispiele der beiliegenden CD-ROM VII. Diskografie VIII. Noten und Partituren IX. Literatur- und Quellenverzeichnis X. Namens- und Sachregister
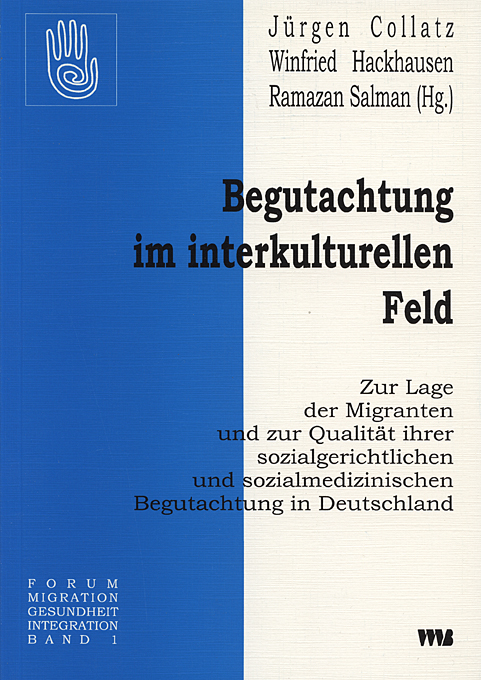
Begutachtung im interkulturellen Feld Zur Lage der Migranten und zur Qualität ihrer sozialgerichtlichen und sozialmedizinischen Begutachtung in Deutschland Jürgen Collatz, Winfried Hackhausen & Ramazan Salaman (Hg.) (Forum Migration Gesundheit Integration, Bd. 1) 1999 267 Seiten zahlr. Abb. u. Tab. 17 x 24 cm EUR 24,00 ISBN 978-3-86135-290-7 Mehr als zehn Millionen Einwanderer (Arbeitsmigranten, Aussiedler, Flüchtlinge) leben und arbeiten in Deutschland, und das z.T. schon seit vielen Jahrzehnten. Ihre Arbeits- und Altersschicksale führen zu einer von Jahr zu Jahr steigenden Nachfrage nach interkultureller Begutachtung in der Gesundheits- und Sozialversorgung. Besonders die vor Jahrzehnten angeworbenen Gastarbeiter kommen nun in ein Alter, wo Entscheidungen sozialer Sicherungssysteme vermehrt anstehen. Die Fragen nach der Notwendigkeit von Rehabilitationsmaßnahmen oder gar einer Frühberentung einerseits und nach deren sozialen Konsequenzen andererseits stellen die Gutachter vor vielschichtige Probleme. Zentrale Fragestellungen dabei sind beispielsweise: - Wie sind die Lebenslagen der Migranten und welche Auswirkungen haben sie auf gesundheitliche Prozesse? - Welche besonderen interkulturellen Aspekte können Qualifikation und Qualitätsmanagement der Begutachtung verbessern helfen? - Welche Schritte müssen zur Qualitätssicherung der Begutachtung ergriffen werden? Nicht nur Sprachprobleme stellen dabei eine Barriere dar. Auch die Schwierigkeiten, sich in die sozialen Normen anderer Kulturen einzufühlen und deren Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit zu erkennen, sind von großer Bedeutung für die gerechte Beurteilung des Einzelfalls. Hinzu kommt auch noch die spezielle Migrationsproblematik und die Unsicherheit vieler Migranten sowohl gegenüber den Normen ihrer eigenen Kultur als auch gegenüber den hier geltenden Verhaltensrichtlinien. Der Band richtet sich an Experten aus medizinischen Diensten, Gesundheitsämtern, Sozialgerichten, Sozialversicherungsanstalten sowie aus Spitzenverbänden der Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und der Politik. Inhalt: W. Hackhausen: Migration und Begutachtung. Vorwort J. Collatz: Einleitung und Überblick Zur Lage von Migranten und zur Auswirkung auf die sozialen Sicherungssysteme F. Schulz-Nieswandt: Auswirkungen der Migration auf die sozialen Sicherungssysteme K. Sieveking: Aufenthalts- und sozialrechtliche Voraussetzungen für die medizinische Begutachtung von Migranten M. David, E. Yüksel, G. Pette & H. Kentenich: Unterschiedliche Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen bei deutschen und ausländischen Frauen. Die Probleme von Migrantinnen in der Frauenheilkunde Y. Bilgin: Spezielle Gesundheitsgefährdung und frühzeitige Alterungsprozesse bei Migranten Qualitäten und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen und in der sozialmedizinischen Begutachtung W. Hackhausen: Qualitätsmanagement in der sozialmedizinischen Begutachtung. Überlegungen zu Entwicklungsperspektiven in der Sozialmedizin, Prävention und Rehabilitation - mit einem Exkurs über die Begutachtung von Arbeitsmigranten H. Pfefferer-Wolf & D. Fabricius: Unbewußtheit im gutachterlichen Prozeß, transkulturell wie intrakulturell. Beobachtungen und Überlegungen aus medizinischer, psychologischer und juristischer Sicht N. Schmacke: Aufgabenfelder des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Bereich Migration und Gesundheit Z. Mohammadzadeh & H.-J. Zenker: Gesundheitssicherung von MigrantInnen durch den ÖGD S. Köhler: Psychosoziale Desintegration und Bewertung der Leistungsfähigkeit Interkulturelle Aspekte sozialgerichtlicher und sozialmedizinischer Begutachtung G. Koptagel-Ilal: Kulturelle Aspekte der Begutachtung - der Stellenwert soziokultureller Hintergründe in Begutachtungsprozessen T.B.R. Kluge: Der fremde Gutachter K. Jahn: Rechtskonflikte und forensische Begutachtung im Strafverfahren mit ausländischen Beteiligten aus psychologischer Sicht - Erste Ergebnisse eines explorativen Forschungsprojektes S. Tuna: Transkulturelle Begutachtung. Beispiele ethnokultureller Bewältigungsstrategien in der Migration - Kasuistiken S. Sprung-Gather: Muttersprachliche Begutachtung der Gastarbeiter aus dem einstigen Jugoslawien. Ein Erfahrungsbericht S. Tuna & R. Salman: Phänomene interkultureller Kommunikation im Begutachtungsprozeß E. Koch: Anamneseleitfaden für Minoritäten in Sozialgerichtsverfahren am Beispiel türkischstämmiger Probanden M. Wiezoreck: Heimweh, Anamnese und Körperbefunde zwischen Kulturen R.G. Siefen: Beurteilungsrisiken bei der kinder- und jugendpsychiatrischen Begutachtung von Migrantenkindern und -jugendlichen D. Denis, M. Bauer & S. Priebe: Die Begutachtung psychischer Störungen nach politischer Haft in der DDR M. Schouler-Ocak: Posttraumatische Belastungsstörung - Bedeutung in der Begutachtung im interkulturellen Feld T. Heise & W. Machleidt: Begutachtung im Rahmen des Anerkennungsverfahren als Asylant. Zur Frage nach posttraumatischer Belastungsstörung am Beispiel zweier Kasuistiken H. Pfefferer-Wolf: Statt einer Zusammenfassung. Von der Notwendigkeit einer interkulturellen Perspektive in der ärztlichen Begutachtung Die Autoren
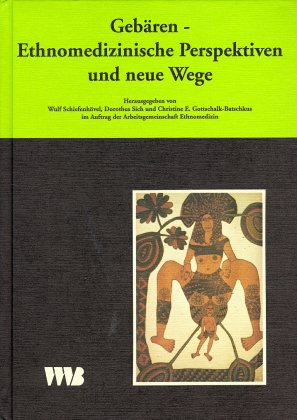
Gebären Ethnomedizinische Perspektiven und neue Wege Hg./Ed.: Schiefenhövel, Wulf / Sich, Dorothea / Gottschalk-Batschkus, Christine E. (curare-Sonderband 8/1995) 461 Seiten 1995 zahlr. Abb. u. Tab. 17 x 24 cm Hc dt. u. engl. EUR 44,00 ISBN 3-86135-560-4 Inhalt/Contents: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im Kulturvergleich C. Loytved: Osiander und die "wilden Völker". Zur Diskussion Natur versus Kultur in der Geburtshilfe um 1800 W. Pulz: Rivalisierende Wissensformen in der Geburtshilfe des 16. und 17. Jahrhunderts B. Jordan: Die Geburt aus der Sicht der Ethnologie I. Albrecht-Engel: Geburt in der Bundesrepublik Deutschland I. Kayankaya: Vorstellungen und Konzepte türkischer Frauen für den Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe N. Dunâre: Rumänische ethnomedizinische Tradition bei der Geburt F. Weiss: Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach - Die Iatmul in Papua Neuguinea W. Schiefenhövel: Geburten bei den Eipo U. Pöschl: Geburten bei den Trobriandern H. Jüptner: Geburtshilflich-gynäkologische Beobachtungen bei den Trobriandern J.L. Fischer: Birth on Ponape: Myth and Reality C. Binder-Fritz: Der Wandel der Geburtshilfe bei den Maori in Neuseeland R. Hartge: Zur Geburtshilfe und Säuglingsfürsorge im Spiegel der Geschichte Afrikas L. Schomerus-Gernböck: Die traditionelle Geburtshilfe bei den Madegassen H. Sheikh-Dilthey: Schwangerschaft und Geburt bei den indo-arabischen Gruppen an der Swahili-Küste L. Kuntner: Geburtshilfe außerhalb des Krankenhauses in traditionellen Gesellschaften W. Föllmer: Besonderheiten der Geburtshilfe in Libyen M.O. Burgos-Lingán: Das kulturelle Verständnis vom Wochenbett im andinen Raum B. Blessin, A. Kroeger: Quantitative Daten zur Schwangerschaft und Geburt in vier Indianergesellschaften Ecuadors C. Nast-Kolb: Ein kulturspezifisches Geburtshilfesystem im andinen Ecuador E. Girrbach: Geburtshilfe als Beruf und Berufung: Quiche-Hebammen in Guatemala Y. Lu: Schwangerschaft und Geburtshilfe im alten China D. Sich: Geburtshilfliche Pathologie im Schnittpunkt des traditionellen und modernen geburtshilflichen Systems in Korea D. Hee Kang: Pregnancy and Child Birth as Rite of Passage in the Korean Family Auf dem Weg zu einer menschlicheren Geburt P. MacNaughton Dunn: Die Geburt als physiologischer Prozeß - eine pädiatrische Sichtweise der Perinatalzeit W. Schiefenhövel: A better Start into Life - Marina Marcovich's New Approach to Treating Premature Babies H. Kirchhoff: Die Geburt in senkrechter Körperhaltung - Kulturhistorische Anmerkungen und mögliche geburtshilfliche Vorteile L. Kuntner: Die Gebärhaltung der Frau C. Mendez-Bauer, J. Arrayo, J. Roberts: Vorteile und Nachteile verschiedener mütterlicher Stellungen während der Geburt M. Odent: Gebärstellung und Gegenkultur D. Cheek: The Role of Unconscious Fear in Causing Premature Labor: Application of Ideomotor Techniques to Stop Premature Labor without Drugs G. Prinz: Verhaltensbeobachtungen bei Geburten im Krankenhaus A. Sack, W. Schiefenhövel: Analyse von 855 Hausgeburten im Münchner Raum C. Naaktgeboren: Über die Hausgeburt in den Niederlanden E. Matsuoka: Is Hospital the Safest Place for Birth? W. Dumont du Voitel: Hebammen im Odenwald R. & C. Linder: Zur Diskussion der Hausgeburtshilfe in Deutschland M. Bäurle: Moderne Facetten eines traditionellen Berufes - Einblick in die freiberufliche Tätigkeit einer Haushebamme 1994 E. Edlinger: Von der Utopie zur Institution: Das 15jährige Bestehen der Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Eltern-Sein e.V. in München T.S. Hüseyin: Construction and Implementation of a Modern Midwifery System in Turkey H. & B. Velimirovic: Die Rolle traditioneller Geburtshelfer im öffentlichen Gesundheitswesen von Entwicklungsländern A. Denzler: Das staatliche Ausbildungsprogramm für traditionelle Hebammen in Ecuador: Ziele, Realitäten, Gefahren A. Denzler: Veränderungen in den Wertvorstellungen der Frauen in der Übergangsgesellschaft im ecuadorianischen Amazonastiefland gegenüber der Geburtshilfe S.F. Bloomfield, C. Loytved: Geburtshilfe im Umbruch - Arbeit und Weiterbildung traditioneller Hebammen in Tonga H. Beittel: Aufklärungsarbeit und Informationsvernetzung zur Durchsetzung der selbstbestimmten Geburt B.A. Schücking: Frauen in Europa - unterschiedliche und ähnliche Erfahrungen während der ersten Schwangerschaft und Geburt L. Janus: Entwicklungen zu einer neuen Kultur im Umgang mit Schwangerschaft und Geburt M. Staubner, W.E. Freud, R. Kästner: Psychosomatische Forderungen an die moderne Geburtshilfe U.W. Geibel-Neuberger: Die soziokulturelle Einbettung von sechs sich entwickelnden Elternschaften bei der Geburt des Kindes aus ethnomedizinischer Sicht H. Lothrop: Gute Hoffnung - Jähes Ende; Trauerverarbeitung und -hilfe für betroffene Eltern bei perinatalem Kindstod W. Schiefenhövel: Nachwort: Der ethnomedizinische Beitrag zur Diskussion um die optimale Geburtshilfe Annotierte Bibliographie Filmographie
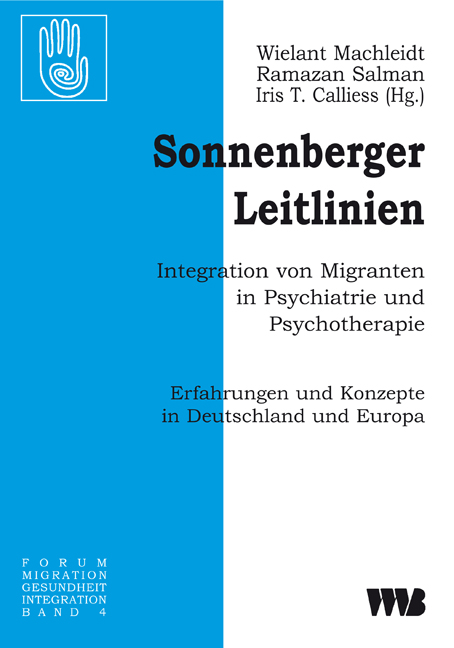
Sonnenberger Leitlinien Integration von Migranten in Psychiatrie und Psychotherapie Erfahrungen und Konzepte in Deutschland und Europa Wielant Machleidt, Ramazan Salman & Iris T. Calliess (Hg.) (Forum Migration Gesundheit Integration, Bd. 4) 2007 304 Seiten zahlr. Abb. u. Tab. 17 x 24 cm EUR 32,00 ISBN 978-3-86135-293-8 Die Sonnenberger Leitlinien legen erstmals verbindliche fachliche und methodische Handlungsperspektiven und Standards für die Verankerung einer kultursensiblen und integrativen Gesundheitsversorgung der Migranten im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie fest. Sie wurden unter Leitung des Ethno-Medizinischen Zentrums, des Referats für Transkulturelle Psychiatrie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), der Deutsch-Türkischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit e.V. (DTGPP) und der Abteilung Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover entwickelt und vereinbart. Beteiligt waren weitere Fachleute aus Praxis, Wissenschaft und Verbänden der Psychiatrie und Psychotherapie. Damit in Zeiten durchlässiger Grenzen auch europäischen Erfordernissen Rechnung getragen werden kann, wurden Expertinnen und Experten aus benachbarten Staaten hinzugezogen, mit denen zusammen politische Erfahrungen und Umsetzungsmöglichkeiten interkultureller Ansätze im Gesundheitsbereich reflektiert wurden. Das Buch richtet sich an Leitungskräfte sowie an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus psychiatrischen Krankenhäusern, psychotherapeutischen und psychosozialen Fachdiensten, Einrichtungen von Länder- und kommunalen Gesundheitsämtern, Universitäten und Akademien. Angesprochen werden in besonderem Maße Ärztinnen und Ärzte sowie Fachkräfte der Therapie, Pflege und Sozialarbeit. Inhalt: Rita Süssmuth: Geleitwort Max Schmauß: Vorwort Eckhardt Koch & Meryam Schouler-Ocak: Grußwort Wielant Machleidt, Ramazan Salman & Iris Tatjana Callies: Einführung Internationale Perspektiven der psychiatrisch-psychotherapeutischen Migrantenversorgung Wielant Machleidt: Die Sonnenberger Leitlinien - Transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland Thomas Hegemann: Perspektiven für die Entwicklung von Standards interkultureller Fachkompetenz in der Psychiatrie Dirck H.J. van Bekkum: Paradigmenwechsel und Kulturkritik - Transkulturelle Psychiatrie im 21. Jahrhundert. Zehn Handlungspunkte aus dem Manifest 2000 der IGGZ in den Niederlanden Joop T.V.M. de Jong: Interkulturelle Öffnung von psychiatrischen Versorgungssystemen in einer multikulturellen Gesellschaft Marianne Kastrup: Integration von Migranten in das psychiatrische Versorgungssystem am Beispiel Dänemarks Rahmenbedingungen, spezifische Arbeitsfelder und methodische Konzepte Christian Haasen, Oktay Yagdiran & Eva Kleinemeier: Kulturelle Aspekte der Diagnostik psychischer Störungen Ramazan Salman: Gemeindedolmetscher in Psychiatrie und Psychotherapie - Konzepte, Handlungsempfehlungen und Leitlinien Dagmar Domenig: Transkulturelle Kompetenz - Eine Herausforderung für die Pflege Renate Schepker: Krisen bei Jugendlichen in Zuwandererfamilien und familiäre Bewältigungsstrategien Simone Penka, Hanna Plake & Andreas Heinz: Ursachen und Auswirkungen der verminderten Nutzung des Suchthilfesystems durch Migranten Ramazan Salman & Ali Türk: Transkulturelle Betreuung - Leitlinien für rechtliche Betreuung von Migranten Iris Tatjana Callies: Fort- und Weiterbildung in Transkultureller Psychiatrie: Ergebnisse einer Umfrage zum Weiterbildungsbedarf Transkulturelle Psychotherapie Marie Rose Moro & Gesine Sturm: Die Differenzierung der therapeutischen Räume in der Therapie von Migranten Günsel Koptagel-Ilal: Kulturelle Grenzen und Grenzüberschreitungen in der Psychotherapie Ilhan Kizilhan: Psychotherapieforschung für Migranten Institutsgebundene Behandlungsstrategien und Modelle Guter Praxis Cornelia Oestereich: Kulturelle Wirklichkeitskonstruktion - Wie man mit und ohne Sprache Wirklichkeiten erfahren, begreifen und verändern kann Jurij Novikov: Makrosoziale, psychologische und psychiatrische Teilaspekte der Emigration und das Problem der Integration von Migranten aus der GUS Eckhardt Koch: Stationäre Psychotherapie von Migranten und die Zusammenarbeit mit einweisenden Ärzten Ibrahim Özkan & Ulrich Sachsse: Das Göttinger Konzept - Versorgung traumatisierter Migranten in psychiatrischen Versorgungssystemen Klaus Hoffman: Psychisch Kranke Migranten im Maßregelvollzug - Eine versorgungs-epidemiologische Erhebung aus Baden-Württemberg Jürgen Hill, Marianne Röhl & Angela Moßler-Schelling: Qualitätssichernde Maßnahmen zur Versorgung von Migranten - Konzeption der Transkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie im Asklepios Klinikum Nord inHamburg Interkulturelle Ambulanzsettings und Prävention Meryam Schouler-Ocak: Integrierte psychiatrische Behandlung von Migranten im ambulanten Setting Ernestine Wohlfahrt, Nadja Kassim & Andreas Heinz: Ein interkultureller Praxis- und Theorieansatz: ZIPP - Zentrum für interkulturelle Psychiatrie, Psychotherapie und Supervision Ahmet Kimil, Björn Menkhaus, Matthias Wienold & Ramazan Salman: Interkulturelle Suchthilfe in Deutschland - Handlungsempfehlungen für Prävention und Beratung Björn Menkhaus & Ramazan Salman: Integration vonMigranten in Angebote der Psychiatrie und Psychotherapie durch interkulturelle Mediatoren und Lotsen unter Nutzung ihrer Stellung im Sozialindex Gesamtliteraturverzeichnis Zu den Autoren

Was ist ein Schamane? Schamanen, Heiler, Medizinleute im Spiegel westlichen Denkens What is a Shaman? Shamans, Healers, Medicine Man from a Western Point of View Hg./Eds.: Amélie Schenk & Christian Rätsch (curare-Sonderband 13/1999 ) 1999 260 Seiten 32 Abb. Hc 17 x 24 cm dt. & engl. EUR 34,00 ISBN 978-3-86135-562-5 Die Erforschung des Schamanentums verzeichnet einen stetigen Aufschwung, die Anzahl der Aufsätze, Bücher und Kongresse nimmt ständig zu, und eine neue Gesellschaft, die International Society for Shamanistic Research, wurde erst kürzlich ins Leben gerufen. Schamanentum ist ein Gebiet, auf dem fast jeder Forscher eine eigenständige Deutung besitzt, daher liegt ein weites Spektrum äußerst unterschiedlicher Forschungsansätze vor. Eine Diskussion der theoretischen Ansätze des Schamanentums wurde bisher nur rudimentär geführt. Wir betrachten es deshalb als sinnvoll, einen Überblick über die derzeit vorliegenden Konzeptionen vorzulegen, was sicherlich einem aktuellen Bedürfnis entspricht. Ziel dieses Sammelbandes ist es, einen internationalen Diskurs anzuregen und die theoretischen Standorte zum Schamanentum abzustecken. Es kommen Wissenschaftler zu Wort, die sich umfassend (generell und weltweit) oder spezifisch (mit einzelnen Kulturen und einzelnen Schamanen in Gestalt von Monografien, Schamanenbiografien und in die Tiefe gehenden Aufsätzen) mit dem Schamanentum beschäftigt haben. Inhalt / Contents: Einleitung (A. Schenk) Å. Hultkrantz: The Unity of Shamanism: Reality or Illusion? M. Oppitz: From One Shaman to the Next H. Kalweit: Der Schamane im Kraftfeld von Geist, Energie und Natur W. Davis: The Art of Shamanic Healing S. Krippner: Close Encounters of the Shamanic Kind: From Meetings to Models R.-I. Heinze: Who are the Shamans of the 20th Century? W. Johnson: The Shaman's Attention Shift: The View from Depth Reality M. Dobkin de Rios: Shamanism and Ontology: An Evolutionary Perspective A. Smith: The Shamanic Archetypal Complex: The Universal Shamanic Experience as a Reflection of our Inherent Psychic Terrain U. Moos: Schamanentum. Weg zu einem alten und neuen Bewußtsein J.W. Kremer: Shamanic Inquiry as Recovery of Indigenous Mind: Toward an Egalitarian Exchange of Knowledge M. Mandelstam Balzer: Multiple Voices: Syncretizing Theories of Siberian Shamans and Anthropological Ancestors J.R. Baker: Consciousness Alteration as a Problem-Solving Device: The Shamanic Pathway A.J. Labbé: Shamanism: An Empirically Based Integrated View of Life M. Winkelman: Shamanic Healers: A Cross-Cultural Biopsychosocial Perspective D. Eigner: Die Kraft der Götter: Tamang Schamanentum in Nepal W.S. Lyon: Four American Myths Concerning Shamanism R. van Quekelberghe: Schamanisches oder integriert-heilendes Bewußtsein K.H. Schlesier: Last Songs J. Horwitz: Apprentice to the Spirits: The Shaman's Spiritual Path A. Schenk: Reise durch die Schamanenwelt C. Rätsch: Nachwort: Sie haben recht!
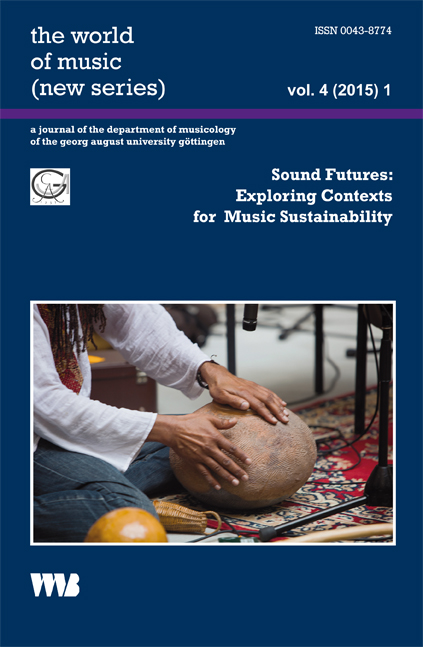
Sound Futures: Exploring Contexts for Music Sustainability Guest Editors: Dan Bendrups & Huib Schippers the world of music (new series)Vol. 4(2015) 1 2015 146 p. fig., photos and musical notations (UVP) EUR 36,00 - EINZELEXEMPLAR ganz leichte Bestoßen an Kante vom Cover - 28 EUR Sonderpreis ISBN 978-3-86135-910-4 Contents: Articles Dan Bendrups & Huib Schippers: Preface: Sound Futures Huib Schippers & Dan Bendrups: Ethnomusicology, Ecology and the Sustainability of Music Cultures Anthony Seeger & Shubha Chaudhuri: The Contributions of Reconfigured Audiovisual Archives to Sustaining Traditions Trevor Wiggins: Music, Education, and Sustainability Zhang Boyu, with Yao Hui & Huib Schippers: Report: The Rise and Implementation of Intangible Cultural Heritage Protection for Music in China Dan Bendrups & Donna Weston: Open Air Music Festivals and the Environment: A Framework for Understanding Ecological Engagement Alison Booth: Producing Bollywood: Entrepreneurs and Sustainable Production Networks Richard Letts. Global Perspectives: The IMC Report on Forces Affecting Music Sustainability Book Reviews (Eva-Maria van Straaten, ed.) Carl Clements: Martin Clayton, Byron Dueck, & Laura Leante (eds.), Experience and Meaning in Music Performance (2013) Louis Regis: Jocelyne Guilbault & Roy Cape, Roy Cape, A Life on the Calypso and Soca Bandstand (2014) Tom Solomon: Philip V. Bohlman (ed.), The Cambridge History of World Music (2013) Eckehard Pistrick: Andreas Gebesmair, Anja Brunner & Regina Sperlich (eds.), Balkanboom! Eine Geschichte der Balkanmusik in Österreich (2014) Anna-Elena Pääkkölä: Babette Babich, The Hallelujah Effect—Philosophical Reflections on Music, Performance Practice, and Technology (2013) Maria S. Guarino: Ian Russell & Catherine Ingram (eds.), Taking Part in Music: Case Studies in Ethnomusicology (2013) Stefan Fiol: Andrew Alter, Mountainous Sound Spaces: Listening to History and Music in the Uttarakhand Himalayas (2014) Stig-Magnus Thorsen: David A. McDonald, My Voice Is My Weapon: Music, Nationalism, and the Poetics of Palestinian Resistance (2013) Recording Reviews ((Robert Fry, ed.) David Knapp: Nudbok al Amar (Dabke on the Moon), DAM. Produced by Nabil Nafar, Jethro Beats, Anan Ksym, and Abed Hathut (2012) Jacqueline Avila: Birdman (Or The Unexpected Virtue of Ignorance). Original Motion Picture Soundtrack. Prodcued by Alejandro Gonzalez Iñárritu (2014) Kayleen Justus: Oui ma Cherie!—Music for Steel Orchestra, Studio Kitchen Crew. Produced by Andy Narell (2014) Lisa Osunleti Beckley-Roberts: Hunter Poetry, WolfHawkJaguar. Produced by Wolfhawkjaguar (2012) the world of music (new series) About the Contributors
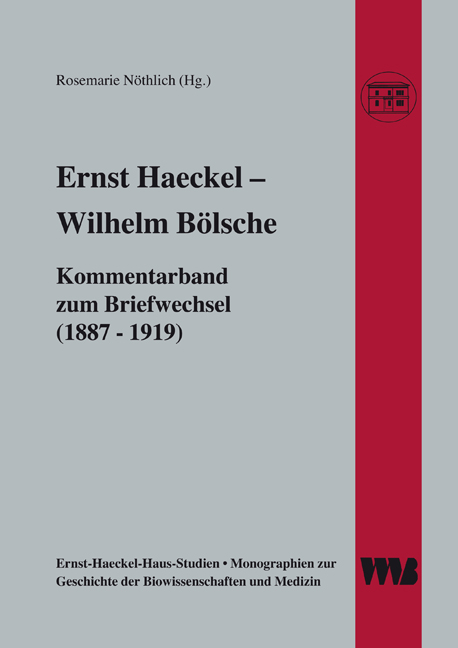
Sound Futures: Exploring Contexts for Music Sustainability Guest Editors: Dan Bendrups & Huib Schippers [the world of music (new series) Vol. 4(2015) 1] 2015 146 p. fig., photos and musical notations (UVP) EUR 28,00 ISBN 978-3-86135-910-4 Contents: Articles Dan Bendrups & Huib Schippers: Preface: Sound Futures Huib Schippers & Dan Bendrups: Ethnomusicology, Ecology and the Sustainability of Music Cultures Anthony Seeger & Shubha Chaudhuri: The Contributions of Reconfigured Audiovisual Archives to Sustaining Traditions Trevor Wiggins: Music, Education, and Sustainability Zhang Boyu, with Yao Hui & Huib Schippers: Report: The Rise and Implementation of Intangible Cultural Heritage Protection for Music in China Dan Bendrups & Donna Weston: Open Air Music Festivals and the Environment: A Framework for Understanding Ecological Engagement Alison Booth: Producing Bollywood: Entrepreneurs and Sustainable Production Networks Richard Letts. Global Perspectives: The IMC Report on Forces Affecting Music Sustainability Book Reviews (Eva-Maria van Straaten, ed.) Carl Clements: Martin Clayton, Byron Dueck, & Laura Leante (eds.), Experience and Meaning in Music Performance (2013) Louis Regis: Jocelyne Guilbault & Roy Cape, Roy Cape, A Life on the Calypso and Soca Bandstand (2014) Tom Solomon: Philip V. Bohlman (ed.), The Cambridge History of World Music (2013) Eckehard Pistrick: Andreas Gebesmair, Anja Brunner & Regina Sperlich (eds.), Balkanboom! Eine Geschichte der Balkanmusik in Österreich (2014) Anna-Elena Pääkkölä: Babette Babich, The Hallelujah Effect—Philosophical Reflections on Music, Performance Practice, and Technology (2013) Maria S. Guarino: Ian Russell & Catherine Ingram (eds.), Taking Part in Music: Case Studies in Ethnomusicology (2013) Stefan Fiol: Andrew Alter, Mountainous Sound Spaces: Listening to History and Music in the Uttarakhand Himalayas (2014) Stig-Magnus Thorsen: David A. McDonald, My Voice Is My Weapon: Music, Nationalism, and the Poetics of Palestinian Resistance (2013) Recording Reviews ((Robert Fry, ed.) David Knapp: Nudbok al Amar (Dabke on the Moon), DAM. Produced by Nabil Nafar, Jethro Beats, Anan Ksym, and Abed Hathut (2012) Jacqueline Avila: Birdman (Or The Unexpected Virtue of Ignorance). Original Motion Picture Soundtrack. Prodcued by Alejandro Gonzalez Iñárritu (2014) Kayleen Justus: Oui ma Cherie!—Music for Steel Orchestra, Studio Kitchen Crew. Produced by Andy Narell (2014) Lisa Osunleti Beckley-Roberts: Hunter Poetry, WolfHawkJaguar. Produced by Wolfhawkjaguar (2012) the world of music (new series) About the Contributors
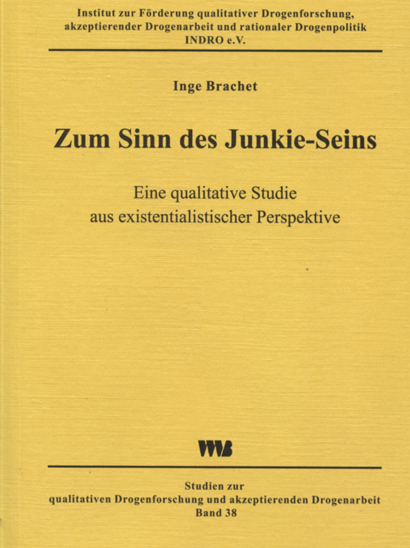
Zum Sinn des Junkie-Seins Eine qualitative Studie aus existentialistischer Perspektive Brachet, Inge (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 38) 2003 239 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 22,00 ISBN 3-86135-248-6 Die individuelle Bedeutung von Heroinabhängigkeit und der Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl wird hier vor einem anthropologisch-existentialistischen Hintergrund betrachtet. Es wird für den Menschen als notwendig angenommen, seinen Wahrnehmungen und Erfahrungen innerhalb bestimmter Strukturen eine subjektive Bedeutung und einen persönlichen Sinn zuzuweisen, was die Orientierung an einem konsensuellen gesellschaftlichen Wertesystem voraussetzt. Sie erlaubt dem Einzelnen, sein Verhalten zu beurteilen und sich als einen wertvollen Menschen zu erleben, sofern er ihren Standards entspricht, und sich gleichzeitig mit anderen zu vergleichen und (positiv) von ihnen abzugrenzen. Das impliziert, daß der Mensch wesentlich auch selbst der Konstrukteur seines jeweiligen aktuellen Selbstkonzepts ist. Heroinabhängigkeit stellt einen Versuch dar, einem durch Eltern und/oder andere mit der Erziehung betraute Personen als indifferent oder widersprüchlich vermittelten Wertesystem und darüber einem Weltbild, dessen Übernahme subjektiv wenig Sicherheit zu vermitteln scheint, ein alternatives Modell zur individuellen Sinnstiftung und Orientierung gegenüberzustellen. Die Aufgabe der Abhängigkeit erscheint nur möglich, wenn es gelingt, einen individuellen Weg der Selbstwertsteigerung zu finden, der weder Rauschmittelkonsum noch die Übernahme des konsensuellen kulturellen Weltbildes erfordert. Heroinabhängigkeit wird damit hier nicht als persönliches Versagen oder "Krankheit" verstanden, sondern unter anderem als ein Sozialisationsdefizit und aus dieser Sicht als fehlgeschlagener Versuch der Individuation. Die Frage, warum die Befragten nicht andere alternative Lebensentwürfe für sich wählen, kann auf der Grundlage der Ergebnisse allerdings nicht beantwortet werden. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie können Konsequenzen für die verschiedenen Ansätzeder Suchtprävention abgeleitet werden. In der Arbeit mit Eltern und insbesondere mit in der Erziehung und Bildung Tätigen erscheint es wichtig, die Bedeutung eines konsistenten Erziehungsstils zu vermitteln sowie konkrete Handlungsmodelle und Übungs- und Begleitungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Inhalt: 1. Einleitung 2. Theoretische und empirische Hinweise zur Fragestellung 2.1 Theoretische Ansätze zum Verständnis von Drogenabhängigkeit aus sozialpsychologischer Perspektive 2.1.1 Sozialpsychologische Theorien zu den Entstehungsbedingungen von Drogenabhängigkeit 2.1.2 Bedeutung von Selbstbild und Selbstwertgefühl zur Entstehung von Drogenabhängigkeit - Themenrelevante Untersuchungen und Befunde 2.2 Überlegungen zum Selbstwertgefühl aus anthropologisch-existentialistischer Perspektive 2.2.1 Grundannahmen der Theorie der Motivation menschlichen Handelns und Sozialverhaltens und der Terror Management Theorie 2.2.2 Grundannahmen der Existentiellen Psychotherapie 2.3 Entwicklung des Selbstkonzepts 2.3.1 Entwicklung des Selbstbildes und Selbstwertgefühls 2.3.2 Konzeptualisierungen von Störungen des Selbstbildes und Selbstwertgefühls unter entwicklungsbezogener Perspektive 2.4 Zum Zusammenhang zwischen Störungen des Sozialisationsprozesses und Drogenabhängigkeit 2.4.1 Bedeutung des Selbstwertgefühls vor dem Hintergrund fehlender Orientierung an konsensuellen Normen und Werten sowie deren Bedeutung für den Beginn und die Beendigung einer "Suchtkarriere" 2.4.2 Akzeptanz konsensueller Normen und Werte und Drogenabhängigkeit - Themenrelevante Untersuchungen und Befunde 2.5 Zusammenfassung und Bezug zur vorliegenden Arbeit 3. Fragestellung und Forschungshypothesen 4. Methodisches Vorgehen 4.1 Relevanz der Datenerhebung durch Interviews 4.1.1 Entwicklung des Interviewleitfadens 4.1.2 Einflußgrößen beim Interview 4.1.3 Durchführung der Interviews 4.2 Technische Durchführung der Interviews 4.3 Integration verschiedener Ansätze zur Auswertung verbaler Daten 4.4 Vorgehen bei der Auswertung der Interviews aus der Untersuchung: Qualitative Inhaltsanalyse und Entwicklung Kausaler Modelle 4.5 Zentrale Aspekte der Ergebnisdarstellung 5. Ergebnisse 5.1 Familiäre Situation in der Kindheit 5.2 Kontakt zu Rauschmitteln 5.3 Motivation, Opiate zu konsumieren 5.4 Motivation für das Verlassen der Drogenszene 5.5 Stabilisierung der Abstinenz der Ex User mit Aufgaben im professionellen Drogenhilfesystem 5.6 Stabilisierung der Abstinenz der Angehörigen der Selbsthilfe von Synanon 5.7 Aufgabe der Hoffnung auf abstinententes Leben der Teilnehmer am Methadonprogramm 5.8 Straftat der Interviewpartner im Maßregelvollzug als "Hilferuf" 5.9 Stabilisierung des Selbstwertgefühl durch Teilnahme am Heroinvergabeprogramm 5.10 Existentielle Aspekte 6. Kausale Netzwerke der interviewten Gruppen 7. Diskussion 7.1 Entwicklungsbedingungen für das Selbstwertgefühl der untersuchten Drogenabhängigen in der Kindheit 7.2 Möglichkeiten der Interviewpartner zur Stabilisierung des Selbstwertgefühls im Jugendalter 7.3 Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und Beginn des Drogenkonsums 7.4 Bedeutung der Aufnahme des Heroinkonsums für das Selbstwertgefühl 7.5 Veränderungen des Selbstwertgefühls im Verlauf der Heroinabhängigkeit 7.6 Zusammenhänge zwischen der aktuellen Lebenssituation und dem Selbstwertgefühl 7.7 Existentialistische Aspekte 7.8 Zusammenfassung der Diskussion 7.9 Mögliche Schlüsse aus den Ergebnissen, Begrenzungen der Studie und Anregungen für weitere Forschungsarbeiten 8. Schlußbemerkung - Konsequenzen aus den Ergebnissen für die Prävention 9. Literatur Anhang
Neuerscheinung 2024, Verfügbar ab Februar2024. Vorabbestellungen möglich Coverabbildung Vorläufig Historische und aktuelle Aspekte der transkulturellen TraumabehandlungJan ¡lhan KızılhanKızılhan Aspekte der transkulturellen TraumabehandlungTherapeutische Konzepte, Langzeitfolgen und Erfahrungen am Beispiel von kriegstraumatisierten Eziden nach dem Genozid
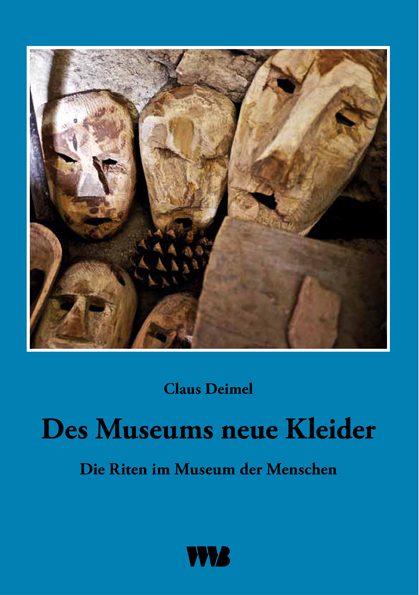
Des Museums neue Kleider Die Riten im Museum der Menschen Claus Deimel 2017 192 Seiten DIN A5 dt. EUR 28,00 ISBN 978-3-86135-283-9 Aufbruch zu neuen Ufern oder alter Wein in neuen Schläuchen? Diese Frage stellt sich bei der Analyse des Istzustandes deutschsprachiger ethnologischer Museen immer wieder. Im Stil einer Ethnographie wird die Entwicklung der kulturpolitischen Situation der letzten 15 Jahre beschrieben – auf Grundlage einer umfassenden Sammlung von Stellungnahmen im Feuilleton und realer Geschehnisse in den Museen: Die Diskursformen und ihre erstaunlichen Ergebnisse. Die Konfusion der Begriffe und die Machtkämpfe um Deutungshoheit. Eine Ethnographie der Gegenwart und des Kulturlebens im Museum. Ritenbeschreibungen, Interviewanalysen. Eine beschreibende Forschung im Feld des Museumsalltags. Von Ausstellungen im postkolonialen Kontext und der globalen Neuordnung. Von den Möglichkeiten neuer und alter Ausstellungen, der praktizierten Sprache in Kunst und Kultur und den Beschränkungen des Zeigens. Vom Humboldt-Forum und seinen identitätsbildenden Momenten der Gegenwart bis zum Gegenentwurf einer Utopie (Das Museum im Untergrund). Eine kritische Analyse politischer Gepflogenheiten und der in Sprache verdichteten Riten, hautnah erlebt und beschrieben. Klarnamen und Klarsituationen. Der Autor war Direktor verschiedener Museen und kuratierte zahlreiche Ausstellungen. Inhalt 1. Zeitlers Steckdose. Zur Einleitung 2. Der Minister kommt in die Sammlung und fragt, ob das alles geklaut sei 3. "How to make them again open the eyes ..." (El Hadji Sy) 4. Change your words, change your world. Aus Volk wird Kulturen 5. Begegnungen im Labor und auf der Bühne alter Meister 6. Eine Lederhose für die ′Namgis First Nation im Norden von Vancouver Island 7. Ein Visum für meinen Poncho 8. Alexander von Humboldt über die "an Einbildungskraft armen mexikanischen Indianer, die zwar europäische Sprachen nur mit größter Schwierigkeit lernen, sich in den ihrigen aber mit äußerster Leichtigkeit ausdrücken" würden 9. Über einen Palast der epochalen Transformation in Berlin-Mitte. Mit dem wortgetreuen Protokoll eines Streitgesprächs: "Schloss für die Welt oder Palast der Verlogenheit?" 10. Das Museum im Untergrund 11. Colorín Colorado 12. Bibliographie 13. Register erwähnter Personen und Museen
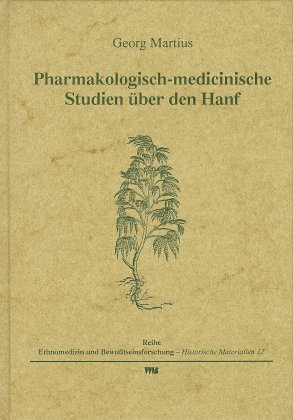
Pharmacologisch-medicinische Studien über den Hanf Martius, Georg (Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung / Historische Materialien Vol.: 12) 1996 X+92 S. Hc 14,8 x 21 cm dt. EUR 16,00 ISBN 3-86135-423-3 Reprint der Ausgabe Erlangen 1855 Georg Martius, der Verfasser der 1855 publizierten Studie zur Pharmazie von Cannabis, formulierte seine Motivation folgendermaßen: "Ich dachte hierbei an den Hanf, dessen Naturgeschichte noch manches Dunkle und Irrthümliche darbot, und der in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der ärztlichen Welt in immer steigenderem Grade auf sich zog. In der Ausführung meines Vorhabens wurde ich bestärkt durch ein reichliches Material, welches sich mir ganz unverhofft darbot: eine werthvolle Sendung frischen Haschisch’s von Herrn Hofapotheker Dr. Steege in Bucharest." Gerade heute hat dieses Buch - das im Original sehr selten ist - wieder eine hohe Aktualität, sollen doch bald Haschisch und Marihuana in deutschen Apotheken verkauft werden. Inhalt: Editorische Notiz Vorwort Literatur Historischer Abschnitt Botanischer Abschnitt Pharmakognostischer Abschnitt Das Hanfkraut Indisches Hanfkraut Afrikanisches Hanfkruat Deutsches Hanfkraut Das Hanfharz Das Haschisch Feste Haschisch-Arten Weiche und flüssige Haschischarten Pharmaceutischer Abschnitt Chemischer Abschnitt Wässriger Auszug des alkoholischen Hanfextractes Weingeistiger Auszug. Das Hanfharz Physiologisch-therapeutischer Abschnitt Anhang. Erläuternde Bemerkungen

Jahrbuch der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen Band XLIV (Jahrbuch der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen) herausgegeben vom Direktor: Claus Deimel 2007 240 S. + 24 Tafelseiten 3 Karten, 77 s/w-Abb. sowie 23 Farbabb Hardcover EUR 24,00 ISBN 978-3-86135-790-2 Inhalt: Vorwort und Ausstellungen für die Jahre 2003 und 2004 Carola Krebs: Radcliffe-Brown, Chicago und die Andamanen Anett C. Oelschlägel: Ressource Wald. Porträt eines südkirgisischen Bergdorfes Diana Altner: Geschichte, Funktion und Konstruktion der Yakhaut-Boote in Zentral- und Südtibet Bettina von Briskorn & Helke Kammerer-Grothaus: Der Tropen- und Kriegsfrontmaler Ernst Vollbehr (1876-1960) Hans Fischer: Töpfe und Scherben. Prozesse der Aufgabe, Übernahme, Abgrenzung und Vereinheitlichung in Papua New Guinea und die ethnographische Wahrnehmung Claus Deimel: Voces del Pueblo Indígena. Alexander von Humboldts Bemerkungen über die Indios in Neuspanien. Und neue Untersuchungen über die politische Sprache der Rarámuri in Nordwestmexiko Jürgen Cain Külbel: NON NOBIS NASCIMUR. Über die Brüderschaft des Konsuls, Bankiers, Kaufmanns und Sammlers Bendix Koppel (1835-1919) mit Alphons Stübel, Wilhelm Reiss und Max Uhle, über seinen Verdienst um die Sammlungen des Museums für V&oum;lkerkunde zu Leipzig und die Verstrickung in die Geschichte um das Goldfloß von Siecha Wulf Köpke: Haben Völkerkundemuseen eine Zukunft? Berichte von Dienstreisen der Kustoden der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen: Claus Deimel, Carola Krebs, Petra Martin, Marion Melk-Koch, Birgit Scheps, Inge Seiwert
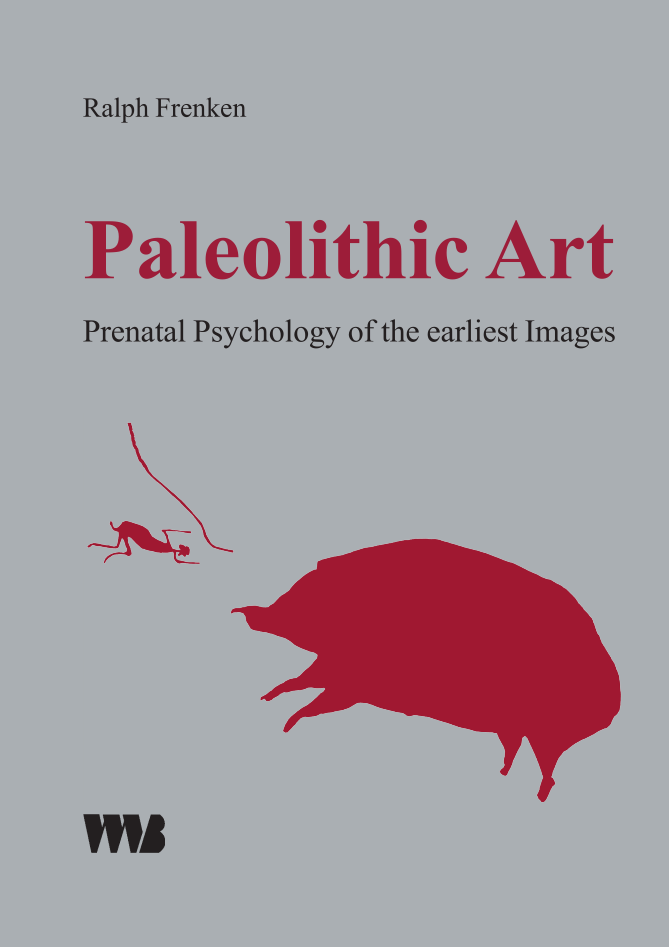
Paleolithic images are fascinating. They contain unconscious aspects that become visible through image interpretations. This book deals with the assumption that the fetus already develops an emotional relationship with its placenta. Human beeings remember their feelings before birth and later express them symbolically in phantasies and dreams, art and religion. Prenatal psychology shows a way to understand both: Paleolithic art and the first love object. Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Informationen zum Hersteller Rolf AglasterVWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung Hubertusstr. 852064 AachenDE aachen@vwb-verlag.de Tel: 0049 241 53809557Fax: 0049 241 53809558
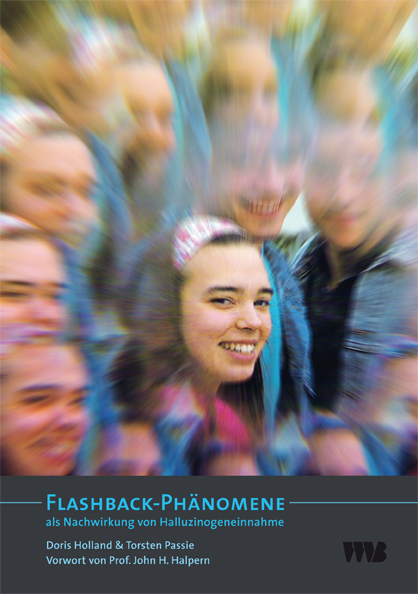
Flashback-Phänomene als Nachwirkung von Halluzinogeneinnahme Eine kritische Untersuchung zu klinischen und ätiologischen Aspekten Doris Holland & Torsten Passie 2011 224 Seiten DIN A5 dt. EUR 36,00 ISBN 978-3-86135-207-5 Halluzinogene Substanzen wie Meskalin, LSD und Psilocybin werden seit Jahrtausenden zur Tranceerzeugung verwendet. Flashback-Phänomene können als Nachwirkung von Halluzinogeneinnahme auftreten. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass ohne erneute Substanzeinnahme kurzzeitige Wahrnehmungsveränderungen auftreten wie sie ursprünglich unter Halluzinogenwirkung erlebt wurden. "Das vorliegende Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Forschung zu Flashback-Phänomenen und die wissenschaftlichen Ansätze zu ihrem Verständnis. In Bezug auf die Erlebnischarakteristik von Flashbacks, ihre Ätiologie und klinische Relevanz kann der Leser eine objektive Darstellung und Einschätzung erwarten." Prof. Dr. John H. Halpern (Harvard Medical School, Boston USA) Dr. med. Doris Holland studierte Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist Ärztin und klinische Psychotherapeutin an der psychotherapeutischen Klinik Tiefenbrunn bei Göttingen. Priv-Doz. Dr. med. Torsten Passie studierte Philosophie, Soziologie und Medizin und habilitierte sich ü,ber "Psychophysische Korrelate veränderter Wachbewusstseinszustände" an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er ist ein international bekannter Experte für Bewusstseinszustände und die Pharmakologie halluzinogener Substanzen. Inhalt Literaturverzeichnis John H. Halpern Vorwort I. Einleitung II. Halluzinogene, Komplikationen und Flashback-Phänomene 1. Halluzinigene Substanzen 2. Mögliche Komplikationen während und nach Halluzinogeneinnahme 3. Halluzinogene, für welche Flashback-Phänomene beschrieben wurden III. Flashback-Phänomene: Stand der Forschung 1. Überblick zur Geschichte der Erforschung von Flashback-Phänomenen 2. Definitionen von Flashback-Phänomenen 3. Auswahl der Untersuchungen 4. Kurzdarstellung ausgewählter Untersuchungen a. Einzelfalluntersuchungen b. Systematische psychiatrische Untersuchungen c. Experimentelle Untersuchungen d. Theoretische Arbeiten IV. Charakteristika von Flashback-Phänomenen 1. Erlebnisveränderungen bei Flashback-Phänomenen 2. Vorkommen und Prävalenz 3. Triggernde Faktoren 4. Zeitdauer V. Erklärungsansätze und Modelle: Übersicht und Beurteilung 1. Psychodynamische Ansätze a. Theorien intrapsychischer Spannungssysteme b "Psychodynamic"-Theorie c. "Intensified Memory"-Theorie d. Theorie der Ich-Schwächung e. Kontrollverminderungs-Theorie f. "Mystical"-Theorie 2. Somatisch-physiologische Ansätze a. Destruktive Effekte auf das visuelle System b. Substanz-Persistenz-Theorie c. Zelltod-Theorie d. Serotonin-Induktions-Theorie e. Serotonin-Hypersensitivitäts-Theorie f. Epilepsie-Theorie g. "Brain damage"-Theorie 3. Lerntheoretische Ansätze a. "Sensitization"-Theorie b. "Unlearning of ASC-Hierarchies"-Theorie c. "Role-learning"-Theorie d. "Self-fulfilling-prophecy"-Theorie 4. Andere Ansätze a. "Stateboundness" Theorie b. Suggestibilitäts-Theorie c. "Hypnotic recall"-Theorie d. "Pre-flashback-personality"-Theorie e. "Latent-psychotic"-Theorie f. "Attentional-deficit"-Theorie g. Wahrnehmungs-Disinhibitions-Theorie VI. Therapeutische Interventionen VII. Eigener Multifaktorieller Ansatz 1. Abgrenzung und Kritik a. Spontane veränderte Bewusstseinszustände bei Gesunden b. Gefährdung und Krankheit durch Flashback-Phänomene? c. Die Hallucinogen Persisting Perceptual Disorder (HPPD): Eine Diagnose und ihre Probleme d. Aktuelle Studien und Diskussionen zur HPPD e. Andere Ursachen visueller Wahrnehmungsabberationen f. Substanzspezifische Differenzen? g. Ein kritischer Blick auf den aktuellen Kenntnisstand 2. Ergänzender theoretischer Bezugsrahmen a. Systemtheorie veränderter Bewusstseinszustände (Charles Tart) b. Trauma-Theorie (Sigmund Freud) 3. Synthese: Konvergenzbezüge ätiologischer Ansätze und eine individuelle multifaktorielle Ätiologie
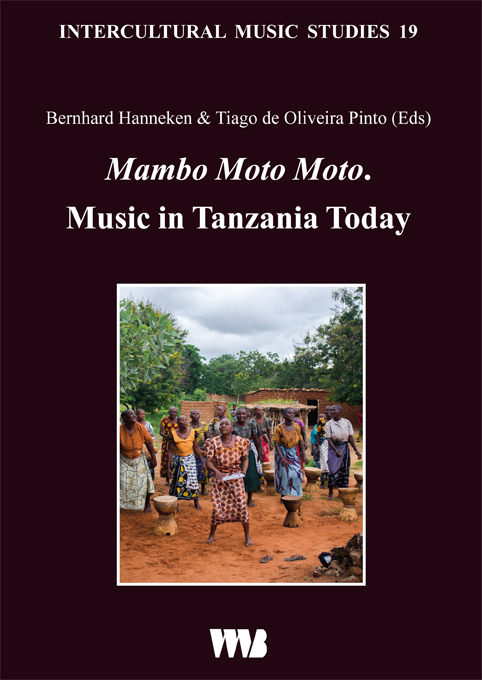
2016 232 pp. Book + 1 DVD numerous Photographs + 8 pp. color plates Index engl. + German abstract 17 x 24 cm EUR 38,00 (UVP) ISBN 978-3-86135-650-9 Looking at the music of present-day Tanzania opens a broad range of perspectives on a multitude of forms of expressions that require a particularly large pluralism of methods. As cooperation und locally added value are no longer blocked out of international musical and cultural activities, the question must be raised how a contemporary musicology may be shaped under these new pretexts. The papers in this volume are vivid proof that also social, historic, commercial, political and other connotations are of interest. Mambo Moto Motoy means something like "hot stuff"—a description that is certainly not amiss when talking about the traditional and contemporary music of Tanzania. The ten contributions deal with musical culture and practise in Tanzania, from the vocal polyphony of the Wagogo women (Gerhard Kubik, Philip Küppers & Kedmon Mapana) to traditional and religious music on Zanzibar and along the Swahili coast (Hildegard Kiel, Aisha Othman), from urban trends (Kelly Askew, Werner Graebner) to the music of the quartet Wamwiduka as an example for transcultural musical processes (Tiago de Oliveira Pinto), and from questions of cultural education (Mitchel Strumpf, Kedmon Mapana) to practical aspects of preserving the treasures of Radio Tanzania (David Tinning). These deeply interesting texts offer a view on music in Tanzania that goes far beyond conventional volumes in musicology as it includes research, inventory, didactic aspects and presentations of projects in equal measure. A 80-minute DVD contains the film With the Drums in their Luggage about the journey of the Ufunuo Muheme Group from their home village in Central Tanzania to Rudolstadt and Weimar in Germany in July 2014. The disc also includes live footage from the bands Dogo Dogo Stars, Jagwa Music, Segere Original, and Wamwiduka. Contents Vorwort Tiago de Oliveira Pinto:Vorwort / Preface Tiago de Oliveira Pinto: African Music in and out of Africa. A Transcultural Approach Gerhard Kubik: The Gogo Tonal-Harmonic System Philipp Küppers & Kedmon E. Mapana: Ng’oma in Chamwino Kelly Askew: Neosocialist Moralities versus Neoliberal Religiousities. Constructing Musical Publics in 21st Century Tanzania Werner Graebner: Other Flavas from Bongo: Mchiriku, Segere & Baikoko—A Look at Alternative Musical Expression in Dar es Salaam Hildegard Kiel: Love, Grief and the Sea Aisha Othman: Maulidi Ceremonies in Zanzibar Mitchell Strumpf: Different Approaches to Music Education in East Africa. The Past Hundred Years Kedmon E. Mapana: Arts in Education. What Do Tanzanians Need to Know? David Tinning: Reviving the Radio Tanzania Archives The Authors Index DVD Mambo Moto Moto at TFF Rudolstadt 2014
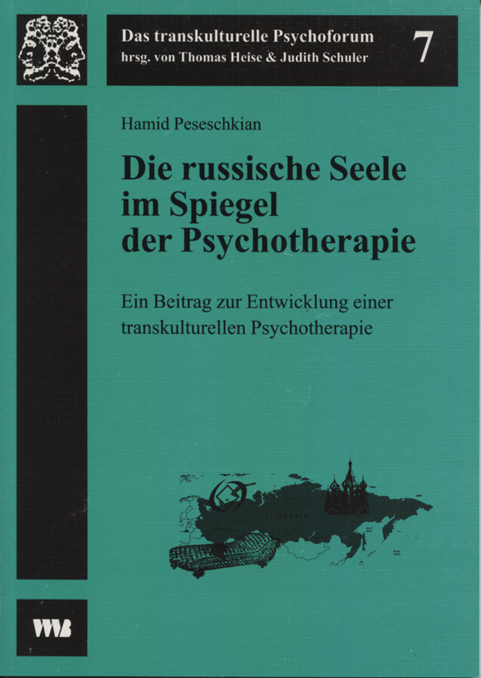
Die russische Seele im Spiegel der Psychotherapie ein Beitrag zur Entwicklung einer transkulturellen Psychotherapie Peseschkian, Hamid (Das transkulturelle Psychoforum, Bd. 7) 2002 128 Seiten Abb. u. Tab. 17 x 24 cm dt. EUR 24,00 ISBN 3-86135-136-6 Gibt es die "russische Seele"? Wie können wir sie aus psychotherapeutischer Sicht beschreiben? Was sind die Probleme der russischen Bevölkerung? Wie funktioniert Psychotherapie im multikulturellen Russland und welche Ansätze sind besonders wirksam? Was können wir hieraus für die Entwicklung einer transkulturell orientierten Psychotherapie lernen? Wie erlebt ein Psychotherapeut und Psychiater die russische Umbruchsgesellschaft? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Autor, der von 1991 bis 1999 als einziger westlicher Psychiater und Psychotherapeut in Russland gelebt und über 30 Regionen vom Baltikum bis zur Insel Sachalin bereist hat. Während dieses Forschungs- und Lehraufenthalts intensive Vortrags- und Lehrtätigkeit an über 25 russischen Universitäten, Gründung von über 20 Zentren für Psychotherapie und Aufbau und Leitung einer neuropsychiatrisch-psychotherapeutischen Poliklinik am American Medical Center in Moskau. Diese Forschungsergebnisse und Erfahrungen führten 1998 zur Habilitation am renommierten Nationalen Psycho-neurologischen Bechterew Forschungsinstitut in St. Petersburg. "Hamid Peseschkian hat ein wichtiges Buch vorgelegt: Er beschreibt die Psychotherapie in Russland und vor allem die Psychotherapie der ersten postkommunistischen Jahre nach 1989, ein wichtiges historisches Aufarbeiten. Er beschreibt aber auch die Kultur Russlands und seiner Vielvölkerdynamik mit seinen Mentalitäten. Seine Jahre in Russland haben ihn zu einem Spezialisten gemacht in dieser Versöhnungsarbeit zwischen und mit den Kulturen. Die Globalisierung hat nicht nur die Ökonomie, sondern auch die Seelen erfasst. Aber welche Modelle der Verständigung insbesondere kranker Seelen haben wir? Mit unseren Verständigungstechniken stehen wir nach 100 Jahren stürmischer Psychotherapieentwicklung am Anfang, aber wir gehen bereits die ersten Schritte, die bekanntlich notwendig sind für den gesamten Weg. Die Psychotherapie in Russland, so wie sie uns Hamid Peseschkian zeichnet, kann diesbezüglich eine sehr gute Quelle der Inspiration sein, gerade in ihren Schwierigkeiten erzählt sie uns mehr über die Conditio Humana als wir zu erwarten geneigt sind." Prof. Dr. Alfred Pritz, Präsident des Weltverbandes für Psychotherapie (WCP) Dr. med. habil. Hamid Peseschkian, 1962 in Wiesbaden geboren, arbeitet als Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in eigener Praxis und ist Geschäftsführer der Wiesbadener Akademie für Psychotherapie. Er ist Vorsitzender des Internationalen Zentrums für Positive und Transkulturelle Psychotherapie (IZPP) und Leiter eines Instituts für Managementtraining. Inhalt: Vorwort des Herausgebers Geleitwort von Prof. Dr. Alfred Pritz Danksagung zur russischen Originalausgabe (1998) TEIL I: Literaturverzeichnis Kapitel 1: Warim Psychotherapie transkulturell sein muss Einführung Zum Begriff der Transkulturellen Psychotherapie Kapitel 2: Ziel, Aufgaben und Methodik der vorliegenden Arbeit TEIL II: Kapitel 3: Die heutige Situation in der russischen Gesellschaft aus psychotherapeutischer Sicht Einige Erläuterungen zum Individualismius-Kollektivismus-Konzept Versuch einer psychologischen Beschreibung der heutigen russischen Gesellschaft unter Berücksichtigung der Konstrukte "Individualismus" und "Kollektivismus" Kapitel 4: Psychotherapie in Russland unter dem transkulturellen Gesichtspunkt - Therapeutisches Arbeiten in einer multikulturellen Übergangsgesellschaft Wirksamkeit und Wirkungsmechanismen von Psychotherapie Kurzer historischer Abriss der Entwicklung von Psychologie und Psychotherapie in Russland Der Patient in Russland (im transkulturellen Vergleich) Der Psychotherapeut in Russland (im transkulturellen Vergleich) Das psychotherapeutische Arbeitsbündnis in Russland (im transkulturellen Vergleich) Die psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung in Russland Kapitel 5: Positive Psychotherapie - ein transkulturelles Vorgehen in der Psychotherapie Das Positive Vorgehen - das Prinzip der Hoffnung und Ermutigung ---- Die Bedeutung von Menschenbildern in der Psychotherapie und Psychiatrie ---- Das Menschenbild in der Positiven Psychotherapie Das inhaltliche Vorgehen Das strategische Vorgehen im "5-Stufen-Modell" Das Konfliktmodell der Positiven Psychotherapie Überblick über die Anwendung der Positiven Psychotherapie in Russland in der Lehre, Ausbildung, Klinik, Praxis und Forschung Kapitel 6: Schlussfolgerungen und Ausblick Analyse der Wirksamkeit der Positiven Psychotherapie in Russland und Feststellung von Kriterien für eine russische Psychotherapie Der transkulturell kompetente Psychotherapeut - Eigenschaften und Menschenbild Zusammenfassung der wichtigsten Thesen und Schlussfolgerungen Ausblick TEIL III: Statistische Erhebung in der transkulturellen Psychotherapie (Russland - Deutschland) Über den Autor
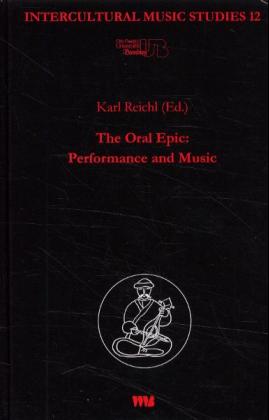
2000 256 S./p. Hc 13,5 x 21 cm engl. (UVP): EUR 34,00 ISBN 978-3-86135-643-1 There is plenty of evidence that both in ancient Greece and in medieval Europe orally performed epics were sung rather than spoken, often to the accompaniment of a musical instrument. Although scholars studying epics such as the Iliad, the Odyssey or the Chanson de Roland have commented on this fact, little progress has been made in incorporating the musical and more generally the performative aspect of oral epic into their interpretations. This is partly explained by the scarcity of musical documents that have come down to us. There is, however, a wealth of comparative material from living traditions and the implications of their study for traditional medieval epics (and possibly also the Homeric poems) form the subject of this book. This book is the first representative survey of the music and performance of oral epic poetry world-wide. It contains a general introduction on the music and performance of oral epics by Karl Reichl (University of Bonn). Contents: Preface Karl Reichl: Introduction: The Music and Performance of Oral Epics Gregory Nagy: Epic as Music: Rhapsodic Models of Homer in Plato's Timaeus and Critias Stephen Erdely: Music of South Slavic Epics Wolf Dietrich: The Singing of Albanian Heroic Poetry Margaret H. Beissinger: Creativity in Performance: Words and Music in Balkan and Old French Epic Dzhamilya Kurbanova: The Singing Traditions of Turkmen epic Poetry Karl Reichl: The Performance of the Karakalpak Zhyrau Emine Gürsoy-Naskali: Dudak degmez: A Form of Poetry Competition among the Asiks of Anatolia Hiromi Lorraine Sakata: The Musical Curtain: Music as a Structural Marker in Epic Performance Carole Pegg: The Power of Performance: West Mongolian Heroic Epics Nicole Revel: Singing Epics among the Palawan Highlanders (Philippines): Musical and Vocal Styles Christiane Seydou: Word and Msuic: The Epic Genre of the Fulbe of Massina (Mali) Joseph Harris: The Performance of Old Norse Eddic Poetry: A Retrospective John Stevens: Reflections on the Music of Medieval Narrative Poetry
