Lieferbare Bücher
Hier finden Sie Bücher aus dem VWB-Verlag, die wir hier schon eingepflegt haben. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir alle noch verfügbaren Titel hier einpflegen.
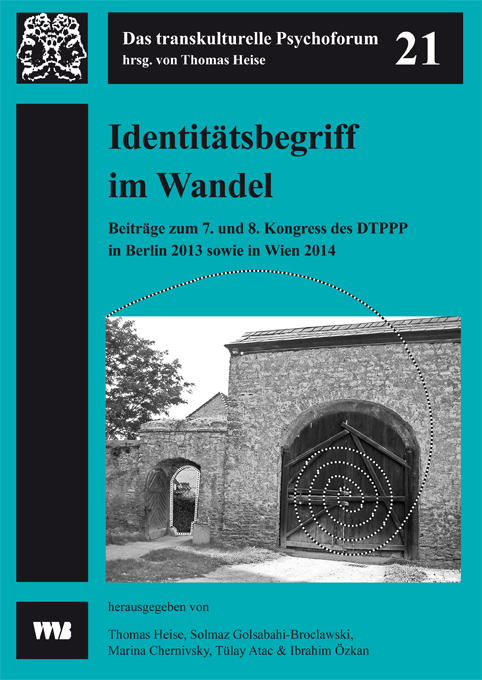
Identitätsbegriff im Wandel Zu Vielfalt und Diversität in Klinik, Praxis und Gesellschaft 7. Kongress 03.–05. Oktober 2013 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie/Campus Charité Mitte/Berlin sowie 8. Kongress 11.–13. September 2014 Allgemeines Krankenhaus Wien des Dachverbands der transkulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum e.V. (DTPPP) Thomas Heise, Solmaz Golsabahi-Broclawski, Marina Chernivsky, Tülay Atac & Ibrahim Özkan (Hg.) 2015 146 Seiten 17 x 24 cm dt. EUR 28,00 ISBN 978-3-86135-195-5 Identitätsbegriff im Wandel In diesem Band des transkulturellen Psychoforums, kommen Beiträge aus zwei Jahrestagungen des Dachverbandes transkulturelle Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum (DTPPP) zusammen: der 7. Kongress mit dem Thema "Identitätsbegriff im Wandel – zu Vielfalt und Diversität in Klinik, Praxis und Gesellschaft" fand vom 03.–05.10.2013 in Berlin statt und der 8. Kongress mit dem Titel "Psychotherapie und Psychopharmakologie im Spannungsfeld der Kultur(en)" wurde vom 11.–13.09.2014 in Wien veranstaltet. Die Jahrestagung in Berlin fokussierte auf die nunmehr seit Jahrzehnten gewachsene gesellschaftliche Wirklichkeit von ethnischer, religiöser und sozialer Vielfalt. Diese wird nicht immer als integrale und selbstverständliche Diversität – als Mehrdimensionalität von Identitäten, Zugehörigkeiten und Lebensentwürfen – aufgenommen. Zur Verbesserung der Versorgungsangebote und einer nachhaltigen Kompetenzerweiterung der Professionellen in Forschung, Praxis und Gesellschaft bedarf es einer diversit¨tsbewussten Medizin, Psychotherapie und Sozialarbeit, die vorurteilsbehaftete Vorstellungen von anderen, Irritationen, Zuschreibungen, Vorwürfe und Missverständnisse bewusst macht und diese reflektiert, damit es nicht zu Fehldiagnosen bis hin zu Behandlungsabbrüchen kommt. Das Thema "Psychotherapie und Psychopharmakologie im Spannungsfeld der Kultur(en)" der Tagung in Wien setzte sich mit dem bis dato vordergründig vorhandenem psychiatrischen Lehrbuchwissen über biologische und psychologische Behandlungstechniken auseinander. Dieses beruht weitgehend unreflektiert nahezu ausschließlich auf Untersuchungen an weißen Europäern und Nordamerikanern aus der Mittelschicht. Durch das von Migrationsbewegungen der letzten Zeit entwickelte Problembewusstsein sollte mit neuen Fächern wie der Ethnopsychopharmakologie, der Ethnopsychoanalyse sowie der trans- und interkulturellen Psychotherapie das psychiatrisch-psychotherapeutische Fachwissen um wesentliche Erkenntnisse erweitert werden. Auf dieser Grundlage der Erkenntnisse soll zu einer besseren Praxis der Behandlung von psychisch belasteten und kranken Migrantinnen und Migranten beigetragen werden. Inhalt: Marina Chernivsky & Tülay Atac: Vorwort Allgemeines und Grundlegendes zur transkulturellen Psycho-Arbeit Thomas Heise:: Migrationen – ein Motor zur Weiterentwicklung der Menschheit Kirsten Nazarkiewicz: Vorteil oder Vorurteil? – Konzepte zum Umgang mit interkulturellen Wissens- und Kompetenzbeständen Hamid Peseschkian: Herausforderungen der psychotherapeutischen Ausbildung und Ausbildungsselbsterfahrung unter Berücksichtigung des transkulturellen Kontextes Selvihan Akkaya: Begegnungen mit psychisch erkrankten Migranten – eine Herausforderung auch für muttersprachliche/gleichsprachliche Behandler Mathilde Pichler: Transkulturelle Psychosomatik im Spannungsfeld – Über kulturelle Fremdheit, Sprachlosigkeit und Somatisierung Friederike B. Haar: Isoliert – Fremd – Zwischen Leben und Tod: Transkulturelle Kommunikationserfordernisse in einem klinischen Setting mit hämatologisch-onkologischen Patienten und deren Angehörigen im Ulmer Kinder- und Jugendklinikum Genderfragen Manuela Marina-Mitrovic, Ida Moranjkic, Hilde Wolf & Natalija Kutzer: "Nichts geht mehr" – Besonderheiten der psychologischen Beratung und Behandlung bei Frauen aus den Nachfolgestaaten des ehemaligem Jugoslawiens Sahap Eraslan: Männlichkeit in der türkischen Kultur Spezifische transkulturelle Themen aus der täglichen Praxis Walter Renner, Ingrid Salem & Richard Gaugler: Kulturspezifische klinische Symptome, der Nutzen kultursensibler Intervention und Schlussfolgerungen für die traumatherapeutische Praxis Nene Heriniaina & L. Joksimovic: Ausdruck von Identitäten in der Kunsttherapie mit FluchtmigrantInnen Michael Henrich: Psychodramatisches Arbeiten im Einzel- und Gruppensetting. Erfahrungen und Grenzen im therapeutischen Setting einer gemischten Gruppe von MigrantInnen Binja Pletzer & Mascha Dabic: Wer ist der Dritte im Bunde? – Doppelagent, Bote oder Rivale? Steht er für Verbindendes oder Trennendes? Ist der Dritte in der Menage-à-trois austauschbar

Mädchenarbeit in der stationären Jugendhilfe Weibliche Lebenswelten, Sozialisationsbedingungen und Konzepte der sozialpä,dagogischen Kompetenzförderung Hg.: Reinhard, Antje & Weiler, Barbara (Forschung und Lernen; Bd. 9) 2003 118 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 14,00 ISBN 3-86135-161-7 Die Gesellschaft konfrontiert Mädchen und Frauen zu Beginn des dritten Jahrtausends in allen Bereichen mit vielfältig veränderten Rollenzuschreibungen. Was auf den ersten Blick als breites Angebot neuer Chancen für weibliche Lebensgestaltung daherkommt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen gerade für Mädchen und junge Frauen in der stationären Jugendhilfe als ambivalenter Balanceakt zwischen dem gesellschaftlichen Versprechen uneingeschränkter Wahlmöglichkeiten und der Faktizität der individuellen, situativen Begrenztheit weiblicher Lebensumstände. Wo liegen die Möglichkeiten sozialpädagogischer Praxis, diese Klientel für den schwierigen Prozess einer kompetenten Lebensplanung und -gestaltung zu stärken und zu fördern? Die vorliegende Arbeit fragt nach den Entwicklungsbedingungen und Merkmalen geschlechtsbezogener Selbst- und Fremdkonzepte, sie untersucht die unterschiedlichen Konzepte sozialer Kompetenz in der gegenwärtigen Forschung und richtet schließlich ihren Fokus auf wesentliche Sozialisationsaspekte von Mädchen in der Heimerziehung. Dabei kommen betroffene Mädchen selbst zu Wort. Ferner werden im Sinne eines Ertrags für mädchenpädagogische Praxis notwendige Perspektiven sowohl im Bereich der Inhalte und Ziel der Jugendhilfe als auch für das Selbstverständnis der weiblichen Fachkräfte in der Betreuung von Mädchen und jungen Frauen aufgezeigt. Inhalt Vorwort

Teegebräuche in China, Japan, England, Rußland und Deutschland Goetz, Adolf 1989 XII+96 S. zahlr. Abb. Hc 14,8 x 21 cm dt. EUR 13,00 ISBN 3-927408-12-3 Reprint mit einer Einleitung von Christian Rätsch "Der Teekult wurde bei uns mehr als nur eine Idealisierung der Form des Trinkens; es ist eine Religion der Lebenskunst. Das Teetrinken wurde allmählich ein Vorwand für die Verehrung der Reinheit und der Verfeinerung, es wurde eine heilige Handlung, bei der Gastgeber und Gast sich zusammenfanden, höchste irdische Glückseeligkeit zu schaffen." (Kakuzo Okakura – Das Buch vom Tee) Inhalt: Christian Rätsch: "Der Schaum von flüssiger Jade" Am Anfang war die Medizin Tee als Aphrodisiakum Pflanzenkulte und Drogenrituale Literaturverzeichnis Adolf Goetz: Teegebräuche Vorrede Teezeremonien - Cha-No-Yu Die Aufbereitung der Teeblätter Englisches Teezeremonial Russische Teeriten Der Tee in Deutschland Fünf-Uhr-Tee mit Tanz Dienst für den Kunden: Die Teetafeln Literatur-Verzeichnis
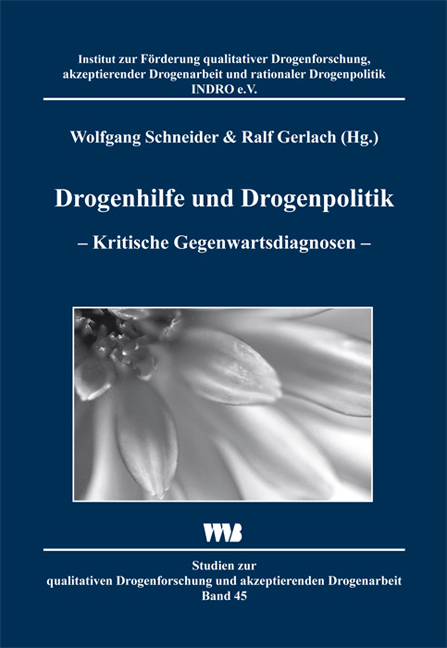
Drogenhilfe und Drogenpolitik. -- Kritische Gegewartsdiagnosen -- Hg.: Schneider, Wolfgang & Gerlach, Ralf 2009 160 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 22,00 ISBN 978-3-86135-258-7 Die Autoren dieses 46. Bandes in der Reihe Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, hrsg. von Indro e.V. werfen einen kritisch-diagnostischen Blick auf die Ausgestaltung gegenwärtiger Drogenhilfe und Drogenpolitik, nehmen sozusagen punktuell eine bilanzierende Gegenwartsanalyse vor, um darauf aufbauend aktuelle drogenhilfepraktische Entwicklungen aus akzeptanzorientierter Perspektive projektbezogen zu beschreiben und praktische Umsetzungsstrategien zu skizzieren. Die Themen reichen hier von "Drogenhilfe unter dem Diktat von Ökonomisierung, Qualitätssicherung, Evaluation und sozialer Kontrolle", "Migration und ambulanter Drogenhilfe", "Psychosoziale Unterstützungsangebote im Rahmen von Substitutionsbehandlungen", "Drogenhilfe und alternde Konsumenten", "Problem- und Risikodroge Cannabis?", "Alkoholkonsum - (k)ein Thema der Drogenhilfe?", "Konsumraum als Ort der Prävention von Drogennotfällen und Drogentodesfällen" bis hin zu "Reise- und Take-Home-Möglichkeiten für Substitutionspatienten". Diese Veröffentlichung ist auch als ein Beitrag zur möglichen Auflösung der drogenpolitischen Erstarrung von Drogenhilfe zu verstehen. Vielleicht eine Utopie?! Inhalt: Vorwort Vorwort Wolfgang Schneider: Der Kunde ist König!? - Drogenhilfe unter dem Diktat von Ökonomisierung, Qualitätssicherung, Evaluation und sozialer Kontrolle Anne Koopmann & Sabine Sturm: Migration und ambulante Drogenhilfe - neue Perspektiven Ralf Gerlach: Psychosoziale Arbeit mit Substituierten - einige unorthodoxe Gedanken jenseits des "Mainstreams" Kristin Ebert & Sabine Sturm: "Alte Hasen - neue Hilfen" - Was muss die Drogenhilfe für alternde Konsumenten tun? Wolfgang Schneider: Problem- und Risikodroge Cannabis?: Zur aktuellen drogenpolitischen Debatte um die Gefahren jugendlichen Cannabiskonsums Kristin Ebert: Alkoholkonsum - (k)ein Thema für die Drogenhilfe? Gil Vogt & Carsten Schmidt: Der Konsumraum als Ort der Prävention von Drogennotfällen und Drogentodesfällen - Ein Beispiel aus Münster; Ralf Gerlach: 10 Jahre Internationale Koordinations- und Informationsstelle für Auslandsreisen von Substitutionspatienten Ralf Gerlach: Take-Home-erordnungen von Substitutionsmitteln für Opiatabhängige bei Auslandsreisen - Positionsbestimmung und Änderungsvorschläge zur aktuellen Rechtslage Autorinnen und Autoren

"Lebensweltliche Orientierung" statt "instruktive Interaktion" Eine Einführung in den Radikalen Konstruktivismus in seiner Bedeutung für die Soziale Arbeit und Pädagogik Kraus, Björn 2000 158 S. 14,8 x 21 cm EUR 16,00 ISBN 3-86135-160-9 Wie gehen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit den "Wirklichkeiten" ihrer Klienten um? Welche Möglichkeiten haben sie, auf diese Einfluß zu nehmen? Wie können sie sich an der "Lebenswelt" ihrer Klienten orientieren und welche Grenzen sind den Prozessen der Verständigung gesetzt? Wie stellen sie sich zu der Frage der "Macht" in der Klientenbeziehung und welche ethischen Maximen können sie in dieser Beziehung leiten? Auf diese Fragen versucht die Arbeit von Björn Kraus eine Antwort zu geben, indem sie auf der Basis des radikalkonstruktivistischen Paradigmas einen systemischen Ansatz zu einer lebensweltorientierten Interaktion entwickelt, der für die Praxis der Sozialen Arbeit fruchtbar gemacht werden kann. Das Buch richtet sich im Sinne einer Einführung an den interessierten Praktiker, der die Möglichkeit einer konstruktivistischen Handlungsorientierung für seine Arbeit kennenlernen und beurteilen möchte; es gibt aber auch wertvolle Anstöße für konstruktivistisch bereits vorgebildete Leser, die Fragestellungen zur Problematik der sozialarbeiterischen Intervention vertiefen möchten. Björn Kraus ist staatlich anerkannter diplomierter Sozialpädagoge und verfügt über Erfahrungen in Praxisfeldern der offenen Jugendarbeit und der stationären Jugendhilfe. Er beschließt gegenwärtig einen von der Systemischen Gesellschaft anerkannten Ausbildungskurs zur Theorie und Praxis der Systemischen (Familien-)Therapie und Beratung und promoviert an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Heidelberg. Björn Kraus, Dr. phil., Diplom-Sozialpädagoge (FH), Systemischer Therapeut und Berater (SG). Erfahrung in offener Jugendarbeit, stationärer Jugendhilfe und in Forschungsprojekten der Sozialen Arbeit. Promotion an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Heidelberg. Gegenwärtig Leiter des Kinder- und Jugendbüros des Stadtjugendamts Kaiserslautern und Lehrbeauftragter in der systemtherapeutisch orientierten Fortbildung in der Sozialen Arbeit an der Evangangelischen Fachhochschule Ludwigshafen. Inhalt 01 Vorwort 02 Einleitung 03 Neurobiologie und "Wirklichkeit" Wahrnehmung Die Funktion von Wahrnehmung Sinnesorgane Die Funktion der Sinnesorgane Informationserzeugung und Informationsverarbeitung bei der Wahrnehmung Kriterien der Wirklichkeitskonstruktion des Gehirns Wirklichkeitskonstruktion mit Hilfe "automatisierter" präkognitiver Leistungen Information und Bedeutung Ds Gedächtnis als Sinnesorgan Die "Wirklichkeit" als Konstrukt des Gehirns Der Unterschied zwischen "Realität" und "Wirklichkeit" Das Gehirn als Teil der konstruierten "Wirklichkeit" Zusammenfassung 04 Wissen als Resultat der kognitiven Auseinandersetzung mit Sinneswahrnehmungen Piagets "Schematheorie" des Lernens in ihrer radikalkonstruktivistischen Bedeutung Assimilation Akkommodation Äquilibration Lernen Viabilität als Ziel der Kognition - Wissen als Konstrukt Jenseits der Erfahrungen im "Hier und Jetzt" Reflexion Abstraktion und Generalisierung Repräsentation 05 Kann der Radikale Konstruktivismus ethische Konseqwuenzen haben? Individualität und der daraus resultierende Pluralismus von "Wirklichkeiten" Ethischer Pluralismus und die Notwendigkeit einer Ethik zweiter Ordnung Die Möglichkeit und Notwendigkeit, vom Sein aufs Sollen zu folgern Das "Wirkliche" Erkenntnissubjekt und der "naturalistische Fehlschluß" Naturalistischer Fehlschluß und Reduktionismus Ethisch Handeln als individueller Akteur in einer Gesellschaft Toleranzgebot Verantwortungsakzeptanz Begründungspflicht Grundannahmen des Radikalen Konstruktivismus und daraus folgernde ethische Maximen 06 Das Schützsche Lebensweltkonzept aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus Phänomenologie Lebenswelt (Schütz) Typik Die drei Relevanzsysteme Die thematische Relevanz Die Auslegungsrelevanz Motivationsrelevanz 07 Folgerungen des radikalkonstruktivistischen Paradigmas für die Praxis der Sozialen Arbeit und Pädagogik Konstruktivistische Verstehenstheorie Lumpes "Wirklichkeitssicht des Komplexen" Die Berücksichtigung des biographischen Wissens Die Theorie der Selbstorganisation Die "Wahrnehmung der Selbstorganisation" (Der Bewußtseinsprimat) Konsequenzen für die Beschreibung der Systeme Sozialarbeiter/-pädagoge, Klient, Sozialpädagogische Situation Homöostase als Ziel der Selbstorganisation (Die Selbststabilisierungsteleologie) Der "Mythos instruktiver Interaktion" 08 Zur Möglichkeit der Einflußnahme auf Lernprozesse Lehren statt Dressieren Umweltstimuli Verstärkung Die mißverstandene Funktion der Sprache Orientierungsfunktion "Soziale" Interaktion Zur Idee eines "richtigen" pädagogischen Handelns 09 Macht Definition: Macht Strukturelle Koppelung Zur Möglichkeit von Macht Macht im materiellen Bereich Exkurs: Instruktive Macht vs. destruktive Macht Macht im kognitiven Bereich Machtspiele Ethische Folgerungen Zusammenfassende Reflexion 10 Schluß 11 Literaturverzeichnis
Heilpflanzen der Seychellen Ein Beitrag zur kreolischen Volksheilkunde Claudia Müller-Ebeling & Christian Rätsch 1989 90 Seiten 14 Abb. 14,8 x 21 cm dt. EUR 10,00 ISBN 3-927408-13-1 Die Inselgruppe der Seychellen befindet sich nördlich von Madagaskar im Indischen Ozean. Auf den einst nur von Urwald, Riesenschildkröten, Krokodilen und Vögeln belebten Granitfelsen siedelten sich im 17./18. Jh. europäische Kolonialherren und Sklaven an. Gewürzanbau, Kokosplantagen und der fischreiche Ozean ermöglichten ihnen ein Leben in paradiesischer Abgeschiedenheit. Auf denselben Grundlagen leben heute die Nachfahren der aus verschiedenen Regionen Afrikas verschleppten Sklaven, der Inder, Chinesen und Europäer. Die kreolische Mischbevölkerung brachte aus ihrer jeweiligen Heimat Heilpflanzen, Heilkonzepte und magische Rituale mit. In einer Zeit, in der die individuellen kulturellen Züge mehr und mehr verschwinden, ist das Wissen um Namen und Gebrauch der Heilkräuter und der enge Bezug zur üppigen Vegetation in allen Gesellschaftsschichten tief verankert geblieben. Die Autoren stellen in diesem Buch die wichtigsten Heilpflanzen zusammen, erläutern ihren Gebrauch im Vergleich mit der Karibik, Mexiko, Indien. Sie führen ein in das Wirken der Weisen des Waldes und Zauberer, in die Welt der Aphrodisiaka, des Liebeszaubers und der Gifte. Inhalt: Einleitung Ethnomedizin der Seychellen Literaturlage Ziel der vorliegenden Arbeit Interkreolischer Vergleich Kreolische Volksheilkunde Die Weisen des Waldes und die Gris-Gris Die Zauberer und die Gifte Das Heiß/Kalt-Syndrom und die mystische Sieben Aphrodisiaka und Liebeszauber Die Heilpflanzen von A-Z Anhang Index der Krankheiten und ihrer wichtigsten Heilpflanzen Index der Pflanzen lateinisch-kreolisch Index der Aphrodisiaka Bibliographie
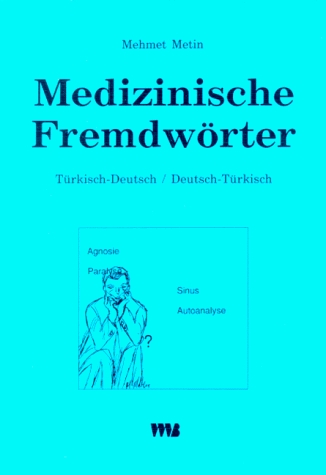
Medizinische Fremdwörter Mehmet Metin Türkisch-Deutsch / Deutsch-Türkisch 1994 48 Seiten 14,8 x 21 cm dt. u. türk. EUR 10,00 ISBN 3-86135-006-8 Die Verständigung zwischen Arzt und türkischem Patient ist immer dann schwierig, wenn beide die Sprache des anderen nicht oder nur unzureichend verstehen. Unter solchen Bedingungen fällt es dem Arzt oft schwer, die Patientenbefragung durchzuführen und dem Patienten die zur Behandlung notwendigen Maßnahmen zu erklären. Auch das Diagnoseverfahren kann durch die Verständigungsprobleme beeinträchtigt werden. Ein zusätzliches Problem schaffen häufig die medizinischen Fachausdrücke, die dem Patienten, zumal dem ausländischen, in der Regel nicht geläufig sind. Dieses kleine Heftchen gibt Ärzten und Patienten ein Hilfsmittel an die Hand, das die Verständigung zwischen deutschen Ärzten und türkischen Patienten verbessert und so zu einer Effektivierung von Diagnoseverfahren und Behandlung beiträgt.

Qigong und Maltherapie. Komplementärtherapien Psychosekranker Thomas Heise 2009 248 Seiten 8 Farbtafeln 17 x 24 cm dt. EUR 38,00 ISBN 978-3-86135-144-3 Seine sinologische Aufarbeitung des "Qigong in der VR China: Entwicklung, Theorie und Praxis" apostrophierte Prof. Scharfetter aus Zürich, einer der bekanntesten Ethnopsychiater Europas, als "einen gegenüber der Flut populärer Literatur soliden Informationsbeitrag über ein dem Westen schwer zugängliches Gebiet."Nun stellt Heise im vorliegenden Werk seine klinische Grundlagen- und angewandte psychiatrische Forschung hinsichtlich des transkulturellen Einsatzes von qigong und bezüglich der Maltherapie dar. Nach einer Skizzierung des maltherapeutischen und körpertherapeutischen status quo betreffend den Einsatz als komplementäre Psychosenpsychotherapie bringt er uns erst die Vorstellung der traditionellen chinesischen Medizin zum Körper-Geist-Seele Problem mit Akzent auf die seelischen Vorstellungen und ihre Therapie nahe, um dann sein Pilotprojekt ausführlich darzustellen. Aufgrund seines durchgehenden Kontaktes seit 1985 zu entsprechenden qigong-Experten und den bekanntesten TCM-Kliniken in der VR China – dankenswerter Weise erst vom DAAD, dann vom niedersächsischen MWK gefördert – kennt er den weltweiten Forschungsstand und bezog dies in seine ungewöhnliche Arbeit, die nach Wolfgang Pfeiffer zur zweiten deutschen Habilitation in transkultureller Psychiatrie und Psychotherapie führte, mit ein. Er betont , dass es für ihn wichtig ist, den bisherigen immer noch überwiegend medikamentösen Psychiatrie-Ansatz zu transzendieren und aufbauend auf eine moderne Sozialpsychiatrie nach neuen Wegen zu suchen, selbst wenn diese unkonventionell sind und gelegentlich missverstanden werden. Seine weitere und diagnostisch breiter gestreute Praxiserfahrung verbunden mit dem Einsatz in der von ihm chefärztlich geleiteten Klinik in Zwickau gab ihm bisher durchaus recht, und weitere Ergebnisse werden folgen.InhaltAndreas Heinz & Theresa Dembler:Traumkörper und Körperträume. Vorwort zum Buch Einleitung 1. Die Bedeutung von leiborientierten Verfahren in der Psychotherapie1.1 Die subjektive Leiblichkeit in der wissenschaftlichen Forschung1.2 Leiborientierte Verfahren bei Psychosen 2. Körperpsychotherapeutische und verwandte Verfahren im Westen2.1 Autogenes Training2.2 Konzentrative Bewegungstherapie2.3 Funktionelle Entspannung2.4 Progressive Muskelrelaxation2.5 Integrative Bewegungstherapie2.6 Bioenergetik2.7 Aerobic2.8 Yoga2.9 Atemtherapien und weitere Verfahren2.10 Einteilung einiger Psychotherapieformen gemäß ihren überwiegenden Komponenten 3. Die Maltherapie 4. Die "Psyche" in ihren Beziehungen zur Theorie der traditionellen chinesischen Medizin4.1 Einführung in die Theorie der traditionellen chinesischen Medizin4.1.1 Medizintheorie mit Diagnostik4.1.2 Die zàngfù Organsysteme in ihren Funktionsbeziehungen4.1.3 Therapeutische Verfahren4.1.4 Die universitäre TCM-Forschung in Deutschland und in China4.2 Traditionelle medizinphilosophische Aspekte zur "Psyche"4.2.1 Die Affektivität im TCM-Medizinmodell4.2.2 Die psychologischen Typen der TCM in Bezug zum qigong4.3.2 Hún – die Hauchseele und pò – die Körperseele sowie andere psychophysiologische Zustände4.3.3 Psychopathologische Zustände4.3.4 Therapeutische Ansätze zur Heilung psychopathologischer Zustände und zur Stabilisierung und Erweiterung psychophysiologischer Möglichkeiten 5. Qigong5.1 Definition des Terminus qigong5.2 Qigong-Rezeption im Westen5.3 Literatur zum medizinischen qigong in der VR China5.4 Allgemeinere Werke5.5 Qigong-Zeitschriften und -Gesellschaften5.6 Moderne chinesische Sichtweise der medizinischen Wirksamkeit des qigong5.7 Zusammenfassung zum "qigong-Fieber" 6. Untersuchungen zum qigong6.1 Qigong-Fragebogenkasuistiken aus der VR China6.2 Der eingesetzte Übungszyklus aus Beidaihe6.3 Ist qigong Psychotherapie?6.4 Untersuchungen zum Einsatz von qigong 7. Die vorliegende Pilotstudie zur qigong-Therapie und Maltherapie7.1 Das Studiendesign7.2 Studientyp7.3 Charakterisierung der Patienten und des Studienablaufs7.3.1 Stand zu Beginn der Studie7.3.2 Stand nach der Zwischenauswertung7.3.3 Stand während der letzten Studienphase7.4 Messungen, Befundungen und Beobachtungen zum Studienablauf7.5 Das Setting der qigong-Therapie7.6 Das Setting der Maltherapie8. Ergebnisse8.1 Patientenkasuistiken und qualitative Auswertung8.2 Abgebrochene Therapien8.3 Testpsychologische Ergebnisse8.3.1 Allgemeine Bemerkungen8.3.2 Soziodemographische und diagnostische Angaben zu den Gruppen8.3.3 MMPI8.3.4 B-L8.3.5 STAI8.3.6 FBeK8.3.7 FAW8.3.8 AT-EVA8.3.9 SCL-90-R8.3.10 BPRS8.3.11 CGI8.3.12 IPC 9. Zusammenfassung9.1 Zusammenfassung der testpsychologischen Ergebnisse9.2 Zusammenfassung der qualitativen Auswertung der Patientenkasuistiken 10. Diskussion der Ergebnisse 11. Literatur Anhang: Farbtafeln
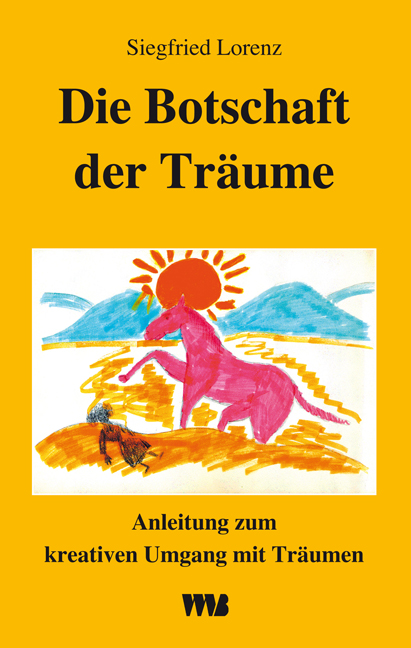
Siegfried Lorenz Die Botschaft der Träume Anleitung zum kreativen Umgang mit Träumen 2008 überarbeitete und erweiterte 2. Auflage 136 Seiten 12,5 x 20 cm dt. EUR 14,00 ISBN 978-3-86135-147-4 "Träume sind Schäume" heißt es im Volksmund. Im Gegensatz zu dieser Volksweisheit steht das Wissen schon alter Völker um die große Bedeutung der Träume. Auch die Psychoanalyse hat die große Bedeutung des Traumes erkannt und ihn als Fundgrube verschlüsselter unbewußter Botschaften entdeckt. Träume sind, wenn wir sie verstehen, unsere wirklichen Ratgeber. Sie geben Aufschluß nicht nur über unsere eigenen Ängste und Probleme, sondern auch über unsere Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte und Zukunftsphantasien. Dieses Buch möchte Sie anregen, sich für Ihre eigenen Träume zu interessieren, sie ernst zu nehmen und sie mit derselben Selbstverständlichkeit wie die tägliche Körperpflege in Ihren Alltag zu integrieren. Damit verschaffen Sie dem Traum die Bedeutung, die ihm zukommt, nämlich Ihr bester Ratgeber zu sein, auf den Sie voll und ganz vertrauen können. Inhalt: Danksagung Vorwort Einführung Das Traumverständnis alter Kulturen Die tiefenpsychologische Interpretation des Traumgeschehens (Sigmund Freud / Carl Gustav Jung / Alfred Adler) Traumforschung Das Traumverhalten bei Kindern und Jugendlichen Verschiedene Träume: (Angst- und Alpträume / Prüfungsträume / Flug- und Fallträume / Todesträume / Schwangerschafts- und [Wieder-]Geburtsträume / Zahnträume / Tierträume / Wasserträume / Feuerträume / Labyrinthträume / Männerträume / Frauenträume) Traumbilder entschlüsseln lernen Erinnerung der nächtlichen Träume (Beispiel für das Führen eines Traumtagebuches / Imaginationsübung) Die imaginative Aufarbeitung von Träumen (3 Imaginationsübungen) Die gestalterische Umsetzung des Traumes (Imaginationsübung) Seminarteilnehmer/innen berichten über die Erkenntnisse, die sie über ihre Träume in den Traumseminaren gewonnen haben Die symbolische Bedeutung der Farben im Traum Kleines Lexikon der Traumsymbole Anmerkungen Literatur
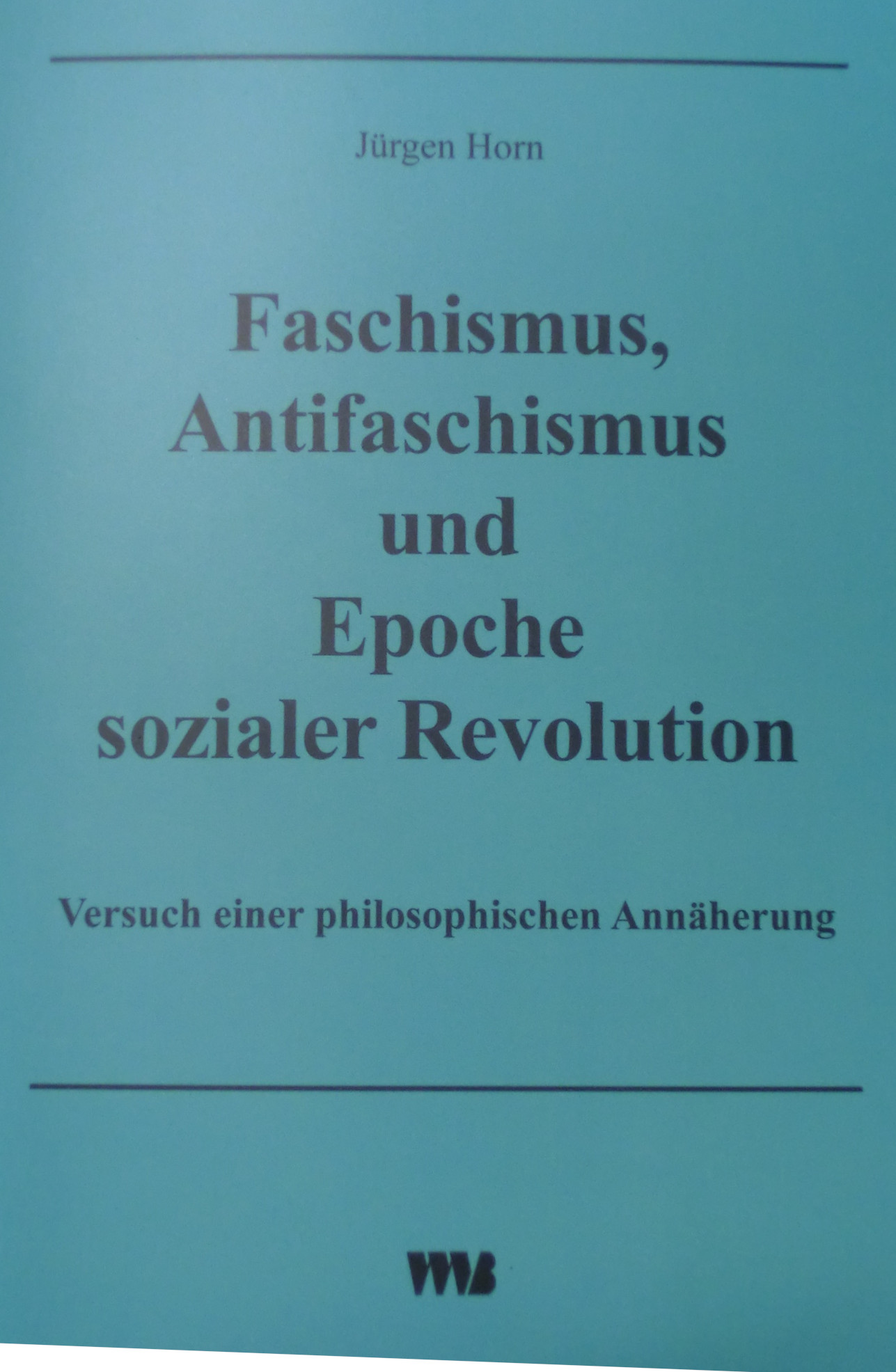
Faschismus, Antifaschismus und Epoche sozialer Revolution Versuch einer philosophischen Annäherung 2022 139 Seiten 14,8 x 21 cm dt. EUR 22,00 ISBN 978-3-86135-999-9 Hier, in diesem Text, ist etwas unternommen worden, was es so eigentlich bisher noch nicht gibt. Es wird versucht, Faschismus nicht als Phänomen des Kapitalismus, sondern als eines von Epoche sozialer Revolution zu verstehen.Das aber stellt eine Reihe von weiterführenden Fragen. Es geht um formationsdialektische Inhalte. Es geht um die Abbildung von Imperialismus nicht aus der Sicht des Funktionierens von Kapitalismus sondern aus einer seines nicht mehr Funktionierens. Und das in der Dimension von Epoche ökonomischer Gesellschafstformation. Das meint Krise, nicht wie landläufig verstanden, als Bestandteil eines Krisen- oder Konjunkturzyklus. Das meint Krise als allgemeine Krise dieses Typus kapitalistischer ökonomischer Gesellschaftsformation überhaupt. ...

Das Selbst und das Nicht-Selbst Die Metaphysik Vivekanandas Bendix, Konstantin 1997 196 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 19,00 ISBN 3-86135-052-1 Vivekananda (1863-1902) ist der erste große indische Denker, der in den Westen ging, um die Lehre der Nicht-Dualität auf dem Grunde der altindischen Schriften zu verbreiten. Seine authentische Deutung indischer Bewußtseinstheorie läßt die im abendländischen Philosophieren seit Descartes` >cogito<, Kant`s >Einheit der Apperzeption< sowie der >Selbstbewußtseinstheorien< des deutschen Idealismus oder Husserls und Sartres an den erkenntnislogischen Problemen des Zirkels und des unendlichen Regresses scheiternden Subjektbegründungen in einem neuen Licht erscheinen. Das Bewußtsein wird im indischen Denken weder als Epiphänomen, wie etwa in der modernen Gehirnforschung, noch als Subjekt-Objekt-Relation, wie in der philosophischen Tradition, gefaßt, sondern als die durch psycho-physische Methoden der Meditation erfahrbare spirituelle >Dimension< des allem zugrundeliegenden >Ungegenständlichen< Selbst als der einzigen Wirklichkeit verstanden. Durch die konsequente Anwendung des Kausalitätsgesetzes auf die Ebene menschlichen Handelns wird die Grundlegung einer Ethik möglich, die auf einer sowohl für die Vernunft als auch das Gefühl befriedigenden Metaphysik beruht. Inhalt: Vivekananda - Wanderer zwischen den Welten Bewußtsein und Wiederkehr Meditation als praktische Metaphysik Die Ethik bindungslosen Handelns Die Religion der Einheit und die Einheit der Religionen Bibliographie
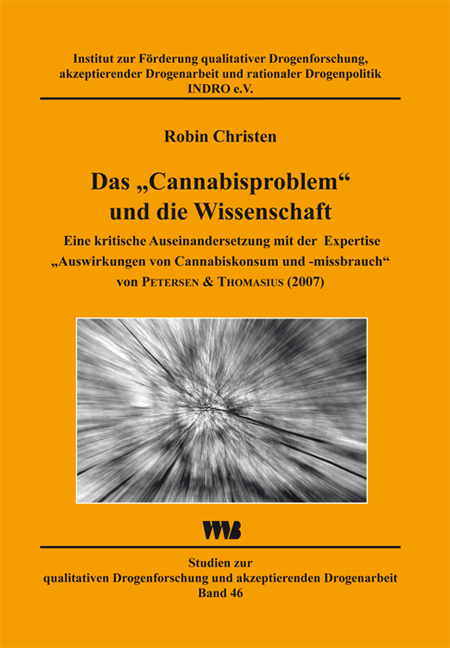
Das "Cannabisproblem" und die Wissenschaft Eine kritische Auseinandersetzung mit der Expertise"Auswirkungen von Cannabiskonsum und -missbrauch"von Petersen & Thomasius (2007) Christen, Robin (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 46) 2009 144 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 20,00 ISBN 978-3-86135-259-3 Sowohl in der Bewertung eines möglichen therapeutischen Nutzens als auch in der Beurteilung gesundheitsschädlicher Konsequenzen bezieht sich die bis heute dominierende naturwissenschaftlich orientierte Cannabisforschung eher auf hypothetische, experimentell an Tieren unter Laborbedingungen gewonnene Annahmen als auf lebensweltnahe, verifizierte Erkenntnisse. Umso erfreulicher ist es, dass nun eine "neue" wissenschaftliche Expertise vorliegt, die den aktuellen Forschungsstand zu den "Auswirkungen von Cannabiskonsum und -missbrauch" unter evidenzbasierter Wissenschaftsorientierung im Sinne medizinischer, qualitätsgesicherter Standards und Leitlinien aufarbeitet. Erfreulich auch, dass es darüber hinaus jemand auf sich nimmt, diese "wissenschaftlich fulminante" Expertise akribisch zu durchforsten, um deren Bedeutung und Aussagekraft für eine "objektive" Einschätzung hinsichtlich der Gefahren des Konsums von Cannabisprodukten zu ermitteln. Der Autor dieses 46. Bandes in der Reihe Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, herausgegeben von INDRO e.V., analysiert systematisch die Fragestellung, Zielsetzung, methodische Aufarbeitung und "evidenzbasierte" Auswertung der Expertise, die als ein systematisches Review der international publizierten Studien zur Cannabisforschung von 1996 - 2006 angelegt ist. Im Ergebnis jedoch entlarvt der Autor diese Expertise als einen weiteren Beleg für einen gesellschaftlich bedeutsamen und somit öffentlichkeitswirksamen, ideologisierenden Diskurs, der sich weiterhin in einer zumeist pathologisierenden, defizitorientierten und zum Teil auch kriminalisierenden Betrachtungsweise manifestiert. Inhalt: Vorwort 1. Einleitung 1.1 Vorgehensweise und thematischer Ablauf 2. Vorstellen der Expertise 2.1 Fragestellung und Zielsetzung der Expertise 2.2 Methoden und Durchführung 2.3 Selektion der verwendeten Publikationen 2.4 Zur Evaluation der Studien des Kerndatensatzes im Ergebnisteil der Expertise 2.5 Beschreibung der Ergebnisse 2.5.1 Organmedizinische Auswirkungen des Cannabiskonsums 2.5.2 Psychische und psychosoziale Auswirkungen des Cannabiskonsums 2.5.3 Neurokognitive Auswirkungen des Cannabiskonsums 3. Epidemiologie 3.1 Der Konsum von Cannabis in der Bundesrepublik Deutschland 3.2 Der internationale Cannabiskonsum 3.3 Ambulant und stationäre Behandlung von Cannabiskonsumenten in Deutschland 3.4 Aktuelle Zahlen und Trends des Cannabiskonsums in Deutschland 4. Evidenz-basierte Medizin 4.1 Der Begriff der Evidenz 4.2 Evidenz-basierte Medizin versus konventioneller Medizin – eine Analyse der Unterschiede 4.3 Vorgehensweisen und Methoden der EBM 4.3.1 Beurteilung einer Studie 4.3.2 Standards, Richtlinien, Leitlinien 4.3.3 Hierarchie der Evidenz 4.4 Formen medizinischer Veröffentlichungen 4.5 Diskussion 4.5.1 Möglichkeiten der Evidenz-basierten Medizin 4.5.2 Grenzen der Evidenz-basierten Medizin 5. Forschungsentwicklung und Forschungsstand 6. Kritische Analyse 6.1 Wissenschaft und Konstruktivismus 6.2 Zu den Begriffen der Wahrnehmung, Wissen, Wahrheit 6.3 Realitä:t und Wirklichkeit 6.4 Soziale Systeme 6.5 Sprache als Aufbau objektiver Wirklichkeit 6.6 Gesellschaftliche Erfahrung und Wissenschaft 6.7 Zusammenfassung 7. Gesellschaftliche Einbettung der Wissenschaft 7.1 Ideologien und Geschichten 7.2 Wissenschaft und Gesellschaftskritik 7.3 Wissenschaftskritik als Methodenkritik 7.4 Diskussion 8. Kritische Untersuchung der Expertise "Auswirkungen von Cannabiskonsum und -missbrauch" 8.1 Diskussion der Befunde und Methoden 8.2 Reaktionen der Fachöffentlichkeit 9. Schlussbetrachtung 10. Literaturverzeichnis

Zur Prävention sexueller Gewalt Strukturelle Grundlagen und pädagogische Handlungsmöglichkeiten Gies, Hedi (Forschung und Lernen; Bd. 6) 1995 138 S. 7 Abb. 14,8 x 21 cm dt. EUr 13,00 ISBN 3-86135-158-7 Patriarchale Familien- und Gesellschaftsstrukturen bilden den Nährboden für sexuelle Gewalt. Nur im kritischen Umgang mit diesen Strukturen kann daher verantwortliches Handeln zur Verhinderung sexueller Gewalt begründet werden. Das Buch vermittelt professionellen HelferInnen und interessierten Eltern einen Überblick über die heutigen Grundlagen präventiver Arbeit zur Vermeidung sexueller Gewalterfahrungen und zur Verminderung sexueller Gewaltpotentiale. Es benennt verschiedene Zielorientierungen der Prävention und diskutiert unter deren Maßgabe entsprechende Handlungsmöglichkeiten in den Feldern der Primär-, Vorschul- und Schulerziehung. Die Autorin zeigt auf, wie Erwachsene sinnvoll Prävention leisten können, wie sie eigene Unsicherheiten im Umgang mit sexueller Gewalt überwinden können und möglichen Folgeschäden im Umgang mit den Betroffenen vorbeugen können. Einleitung Sexuelle Gewalt Was ist sexuelle Gewalt Zum Begriff sexuelle Gewalt Definition Gesetzliche Grundlagen Die Paragraphen Das Strafmaß Theoretische Festlegung und praktische Anwendung Gesellschaftlicher Kontext Die staatliche Gewalt Gewaltdefinition Die strukturelle Gewalt Die personale Gewalt Die patriarchale Gesellschaft Kennzeichen der patriarchalen Gesellschaft Sexuelle Gewalt und patriarchale Gesellschaftsstruktur Auswirkungen der Mythen Sozialisation Der gesellschaftliche Kontext am Beispiel Schule Sexismus und sexuelle Gewalt in der Schule Leistungsdruck Sexuelle Gewalt an Kindern durch Lehrkräfte Ausprägung sexueller Gewalt Stand der Forschung Häufigkeit Dauer Orte der Übergriffe Geschlecht der Betroffenen Alter der Betroffenen Die Täter Geschlecht der Täter Psychosoziale Merkmale Sexualität - Gewalt Alter der Täter Bekanntschaftsgrad zwischen Täter und Betroffenen Selbst erlebte (sexuelle) Gewalterfahrungen der Täter Familiärer Kontext Familienklima Eineltern- und Stiefvaterfamilien Die Rolle der Mutter Die Rolle des Vaters Voraussetzungen für sexuelle Gewalt Der Mythos von der kindlichen Initiierung Taktiken und Strategien der Täter Geheimaltungsgebot Die Wahrheit kindlicher Aussagen Abwehrstrategien, Signale und Folgen sexueller Gewalt Abwehrstrategien und Signale Altersspezifische Signale Beendigung der sexuellen Gewalt Aufdeckung der sexuellen Gewalt Die Auseinandersetzung mit der Mutter Folgen Altersunspezifische Folgen Altersspezifische Folgen bei Mädchen Emotionale Reaktionen und Selbstwertgefühl Soziale Beziehungen Sexualität Psycho-somatische Beeinträchtigungen Die Auswirkungen auf Jungen und Männer Fazit Grundlagen der Prävention Darstellung der früheren Präventivmaßnahmen Kritik an früheren Präventivmaßnahmen Die Entwicklung der Präventionsarbeit Das Child Assault Prevention Project Darstellen des CAPP-Programms Kritik des Deutschen Kinderschutzbundes am CAPP-Programm Präventionsverständnis Normative Implikationen Hilfeorientierung Definitionsgrundlagen Weitere Kritikpunkte am CAPP-Programm Prävention von sexueller Gewalt heute Grundlagen der Prävention mit Erwachsenen Informationen Sexualität Gefühle Grenzen Helfen und Hilfe holen Fazit Grundlagen der Prävention mit Kindern Ist Prävention mit Kindern sinnvoll? Ziele der Prävention mit Kindern Aufklärung über sexuelle Gewalt Inhalte der Prävention Das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung Das Recht auf die eigene Intuition Berührungen Das Recht auf Widerstand und Ungehorsam Gute und schlechte Geheimisse Das Recht auf Hilfe und Unterstützung Erwachsene machen Fehler Weitere Präventionsregeln Gesellschaftliche Situation und Voraussetzungen für Prävention Gesetzliche Voraussetzungen Kinder in der Hierarchie Väter und Kindererziehung Soziale Isolation Die strukturelle Gewalt am Beispiel Schule LehrerInnerausbildung Fort- und Weiterbildung Öffentlichkeitsarbeit Benennung der Ursachen sexueller Gewalt Aufklärung über sexuelle Gewalt Reduktion der Isolation Handlungsmöglichkeiten Handlungsmöglichkeiten durch die Erziehung Die Grundhaltung bei der Erziehung Auswirkungen in bezug auf sexuelle Gewalt Körperliche Grenzen Hilfen für den Erziehungsalltag Geschlechtsrollenerziehung Forderungen an die Mädchenerziehung Forderungen an die Jungenerziehung Handlungsmöglichkeiten durch Sexualerziehung Hindernisse bei der Sexualerziehung Mögliche Folgen fehlender Sexualerziehung Inhalte der Sexualerziehung Sexualerziehung als Prävention von sexueller Gewalt Voraussetzungen für die professionelle Hilfe Anknüpfung am alltäglichen Umgang Auffangen möglicher Opfer sexueller Gewalt Wissen, Einstellung und Kompetenz der professionellen HelferInnen Ein breiter Ansatz Gemischte oder geschlechtshomogene Gruppen Geschlecht der professionellen HelferInnen Zielsetzungen Handlungsmöglichkeiten im Kindergarten Präventionsarbeit mit Kindern im Kindergarten Präventionsarbeit mit Eltern Grundsätzliches zu einem Elternabend mit dem Thema sexuelle Gewalt Inhalte des ersten Teils Inhalte des zweiten Teils Handlungsmöglichkeiten in der Schule Voraussetzungen für LehrerInnen Selbstreflexion Institutionelle Rahmenbedingungen Vorbereitende Präventionsthemen Sexuelle Gewalt im Sexualkundeunterricht? Prävention als Erziehungshaltung Umgang mit Verdacht und Aufdeckung in der Schule Besonderheiten Ausländische Kinder Sonderschule Praktisches Beispiel für Präventionsarbeit in der Schule Eine Unterrichtseinheit für das 3. Schuljahr Umgang mit Verdacht und Aufdeckung Zum Umgang mit einem Verdacht Hindernisse bei der Aufdeckung Zum Umgang mit der Aufdeckung Strafanzeige ja oder nein? Sekundärschädigungen Handlungsmöglichkeiten in der Sozialarbeit Voraussetzungen für die Sozialarbeit Mädchenarbeit Jungenarbeit Jungenarbeit ist nicht gleich Mädchenarbeit Selbstwertgefühl stärken Umgang mit Grenzen Unterschiedliche Konzepte in der Jungenarbeit Didaktische Perspektiven Praktische Beispiele für die Sozialarbeit Eine Veranstaltungsreihe ‘Frau und Schule’ Regionale Präventionsarbeit Ausblick Literaturverzeichnis
Das Respiratorische Feedback nach Leuner Hg./Ed.: Gerhard S. Barolin 2001 196 S. 20 Abb. 12,5 x 20 cm dt. EUR 23,00 ISBN 3-86135-108-0 Der Name Leuner ist vor allem mit der Entwicklung der Katathymen Imaginations-Psychotherapie verbunden. In seinem späteren Lebensabschnitt hat er sich aber vermehrt dem Respiratorischen Feedback zugewandt und es entwickelt. Es ist eine apparativ unterstützte Psychotherapie, die in ihrer Auswirkung wesentliche Anklänge an das Autogene Training hat, aber demgegenüber rascher therapeutische Dimensionen erreichen kann. Leuner arbeitete an einem zusammenfassenden Buch darüber, doch dabei hat ihn der Tod hinweg genommen. Der österreichische Arzt und Psychotherapeut Barolin war mit Leuner eng verbunden, hat schon in den 60er Jahren mit ihm in Göttingen an der Katathymen Imaginations-Psychotherapie gearbeitet und durch Entdeckung der spontanen Altersregression einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Er hat auch mit dem Respiratorischen Feedback langjährige Erfahrungen gesammelt und nun auf sich genommen, aus den erhaltenen Fragmenten des Leiner'schen Buch-Konzeptes über das Respiratorische Feedback und einer Anzahl von diesbezüglichen Beiträgen anderer erfahrener Psychotherapeuten den derzeitigen Wissensstand darüber erstmalig zusammenzufassen. Das RFB ist einerseits noch relativ neu oder wenig bekannt, andererseits sind jedoch die Erfahrungen der damit Arbeitenden äußerst günstig, es besticht die Breite der Anwendbarkeit: von der Kinder- bis zur palliativen Psychotherapie, von der Krisenintervention übergehend in längere und tiefergehende Psychotherapie und nicht zuletzt die Anwendungseinfachheit und Raschheit der Wirkung. Das vorliegende Werk soll einem breiteren Kreis die neuen guten Wege zum wohle der Patienten eröffnen. Inhalt: Die Autoren G.S. Barolin: Vorwort G.S. Barolin: Das Respiratorische Feedback (RFB) - Basis und Praxis H. Leuner & H.K.A. Manshausen: Patientenanweisungen H. Leuner: Manuskriptfragmente H. Wätzig: Respiratorisches Feedback bei Kindern, Notfällen und psychosomatischen Erkrankungen H. Wätzig: Das RFB in Erfahrung und Einschätzung von damit arbeitenden Therapeuten Chr. Schenk: Ergänzungen zum RFB bei Kindern und Jugendlichen A. Bergdorf: Psycho-Onkologie und Schmerzbehandlung mit dem Respiratorischen Biofeeedback H. Horinek: Allgemeinmedizin und Psychosomatik H. Hörnlein-Rummel: RFB als Gruppentherapie W. Loesch: Erfahrungen mit dem Respiratorischen Feedback nach LEUNER in der Therapie chronischer Schmerzpatienten A. Horn: Dasv Respiratorische Feedback bei Multiple Sklerose H.K.A. Manshausen: Technik und Händlernachweis

Siegfried Lorenz Seelische Katastrophen als Chance Wie Kinder und Jugendliche durch Therapie ihre seelischen Verletzungen überwinden und ihr wahres Selbst finden 1994 113 Seiten 21 Abb. 14,8 x 21 cm dt. EUR 13,00 ISBN 3-86135-011-4 In der psychoanalytischen Therapie spielen Bilder ebenso wie Träume, Phantasien und andere schöpferische Gestaltungen eine wichtige Rolle. Sie kommen aus dem Unbewußten und enthalten eine Botschaft, die symbolisch verschlüsselt ist. Zur Entschlüsselung der Symbole wird auf die Tiefenpsychologie zurückgegriffen, die sich auch in der Traumdeutung bewährt hat. Ein Symbol ist niemals statisch und darf nie nur eindimensional betrachtet werden. Nach C.G. Jungs Verständnis ist das Wesentliche am Symbol seine Mehrschichtigkeit und Lebendigkeit. Es ist gleichsam geladen mit Kraft aus dem schöpferischen Urgrund, ist Teil des in uns liegenden Lebendig-Schöpferischen. Das Erleben und Durchleben der Symbole mit den dazugehörenden Gefühlen und Affekten aktiviert nicht nur schöpferische Kräfte in uns, sondern darüber hinaus werden auch innerseelische Prozesse in Gang gesetzt, die bewirken, daß unbewußte, verschüttete psychische Persönlichkeitsanteile wieder ins Bewußtsein integriert werden. Die Folge ist, daß psychische Störungen sich auflösen und es zur Heilung kommt. Bei den beschriebenen Fallstudien handelt es sich um Kinder und jugendliche Patienten mit unterschiedlichen seelischen Störungen, die der Autor ein Stück auf dem Weg zur Heilung begleitet hat. Inhalt: Danksagung Einleitung Warum näßt ein 6jähriger Junge wieder ein Regressive Wünsche eines kleinen Mädchens, das nicht mehr sprechen wollte Heilung eines jugendlichen Exibitionisten Ein gut begabter Jugendlicher kann plötzlich nicht mehr lernen Schulangstbewältigung mit Hilfe der Phantasie Wiedergeburtserlebnis eines 16½jährigen Jugendlichen mit Harnverhaltung Lebensunlust und Antriebslosigkeit eines 9jährigen Jungen. Was steckt dahinter? Glossar Literatur
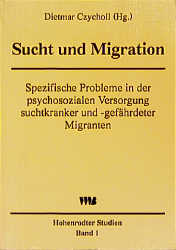
Sucht und Migration Spezifische Probleme in der psychosozialen Versorgung suchtkranker und -gefährdeter Migranten Hg.: Czycholl, Dietmar (Hohenrodter Studien; Bd. 1) 1998 131 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 15,00 ISBN 3-86135-251-6 In der Bundesrepublik leben mehr als neun Millionen Migranten: über zwei Millionen Aussiedler, die in den letzten Jahren zugewandert sind und über sieben Millionen Ausländer. Legt man nur die allgemein gültigen Verteilungen zugrunde, ergibt sich als Schätzung die Zahl von mindestens 300.000 Migranten, die von Alkohol, Medikamenten oder illegalen Drogen abhängig sind. Für diese Kranken gibt es aber kaum Hilfeangebote, die ihre besondere Situation, ihre Integrationsprobleme und die jede rechtzeitige Behandlung erschwerenden Sprachbarrieren angemessen berücksichtigen. Einige Aspekte dieser Problematik und ihrer Hintergründe sowie verschiedene Ansätze, dieser Problematik zu begegnen, werden im vorliegenden Band beschrieben und diskutiert. Inhalt: Vorwort T. Reuther: Ausländerpolitik gescheitert?! Grundlagen einer neuen Integrationspolitik für Fremde R. Salman: Interkulturelle Suchthilfe. Prävention und Beratung für Migranten in Hannover R. Salman: Spezifische gesundheitliche Lage und Belastungen der Migranten D. Czycholl: Ohne Chance im gelobten Land. Rauschmittelprobleme bei Aussiedlern H. Heidebrecht: Deutsche aus Rußland. Lebens- und Migrationserfahrungen R. Giest-Warsewa: Junge Aussiedler. Problemlagen in der BRD und Sozialisationserfahrungen in der GUS D. Czycholl: Entwicklungen einer spezialisierten Konzeption für die stationäre Therapie suchtkranker Migranten A. Braun: Methodische Gesichtspunkte der Diagnostik und Therapie bei rauschmittelabhängigen Aussiedlern K. Kulinski: Migration und die Folgen M. Streicher: Ausländer und Aussiedler in der stationären Therapie Literatur Verzeichnis der Autoren

Helden rauchen nicht!? Darstellung, Rezeptionsannahmen und Zensur von Drogen imcomic am Beispiel der Comicserie Lucky Luke Thomas, Gesa (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 43) 2006 171 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 24,00 ISBN 3-86135-255-9 ISBN-13 978-3-86135-255-6 Comics spiegeln - wie andere Medien auch – durch deren Thematisierung die gesellschaftliche und kulturelle (Be-)Deutung von Drogen durch deren Thematisierung wider.Mit der von Gesa Thomas am Institut für Kriminologische Sozialforschung der Universität Hamburg erarbeiteten Studie liegt erstmals eine Untersuchung des Mediums Comic vor, in der der Umgang mit der Drogenthematik im Comic aus kriminologischer Perspektive betrachtet wird.Das Buch bietet nicht nur Comicliebhabern, an der Drogenthematik Interessierten oder Kriminologen aufschlussreiche Blicke auf die gesellschaftlichen Dramatisierungs-, Skandalisierungs- und Kriminalisierungsprozesse in Bezug auf die Darstellung von Drogen im Comic und die bestehenden Annahmen über deren Rezeption. Am Beispiel der seit 60 Jahren erscheinenden Comicserie Lucky Luke wird aufgezeigt, wie formelle und informelle Zensur die Darstellung von legalen und illegalen Drogen im Comic beeinflusst. Die Drogendarstellung wird in den Kontext der Drogengeschichte gesetzt, um festzustellen ob die Darstellung frei gestaltet wird oder den bestehenden moralischen Ansprüchen angepasst werden muss.Inhalt: Vorwort EinleitungI. Comic, Drogen und Zensur1. Kriminologischer Hintergrund2. Comic und Comic-Zensurgeschichte2.1 Die u.s.-amerikanische Comicgeschichte2.1.1 The golden age of comics2.1.2 Kriminalität in Comics und Moralunternehmertum: der Comic gerät in Verruf2.1.3 Der Comic Code2.1.4 Spidermans Kampf gegen Drogen und den Code2.1.5 Der Code verliert die Macht2.2 Die frankobelgische Comicgeschichte2.2.1 Das französische Gesetz zum Schutz der Jugend und der Code moral2.2.2 Der Comic wird zum Kulturgut2.3 Die deutsche Comicgeschichte2.3.1 Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften2.3.2 Die freiwillige Selbstkontrolle für Serienbilder2.3.3 Schmutz und Schund ins Schmökergrab2.3.4 Der Comic wird gesellschaftsfähig2.3.5 Comics in der Deutschen Demokratischen Republik2.4 Blick nach Japan3. Der Comic in der Wissenschaft3.1 Konservative Wirkungsforschung3.2 Moderne Wirkungsforschung3.3 Comic-ForschungII. Darstellung von Drogen in Lucky Luke4. Qualitative Untersuchung von Lucky Luke4.1 Warum Lucky Luke4.2 Das Sample der Untersuchung4.2.1 Die Auswahl der Drogen4.2.2 Die Auswahl der Alben4.3 Die angewandte Methode5. Überblick über die Geschichte von Lucky Luke5.1 Die Autoren5.2 Entstehung und Verlauf der Veröffentlichungen5.2.1 Französischer Sprachraum5.2.2 Deutscher Sprachraum5.3 Der Kosmos des Lucky Luke5.3.1 Die Figuren5.3.2 Die zeitliche und thematische Einordnung der Serie6. Überblick über die Beeinflussung der Darstellungen innerhalb der Serie6.1 Verlagsauflagen6.2 Zensur und Moralunternehmertum bei Lucky Luke6.2.1 Das französische Gesetz zum Schutz der Jugend und der Code moral6.2.2 Deroca-Cola Konzern6.2.3 Die Hanna-Barbera-Studios und die Anti-Raucher-Bewegung Exkurs: Umsetzung des Nichtrauchens von Lucky Luke im deutschen Sprachgebiet7. Auswertung7.1 Das Drogenvorkommen in der Serie7.1.1 Tabak7.1.2 Alkohol7.1.3 Koffein7.1.4 Kokain7.1.5 Wunderelixiere7.1.6 Opiate7.1.7 Halluzinogene7.2 Das Drogenkonsumverhalten von Lucky Luke7.3 Das Drogenkonsumverhalten anderer Figuren7.4 Die inhaltliche Darstellung von Drogen7.4.1 Drogen als thematischer Inhalt der Handlung7.4.2 Darstellung von Drogenkonsum als Genuss7.4.3 Darstellung von Drogen im Zusammenhang mit Kriminalität7.4.4 Darstellung von gesundheitlichen Aspekten des Drogenkonsums7.4.4.1 Gesundheitsfördernde Wirkung7.4.4.2 Gesundheitsschädigende Wirkung7.4.5 Darstellung der Mäßigkeitsbewegung und von Gegnern des Drogenkonsums7.5 Abschließende BewertungResümee Literaturverzeichnis Bildnacxhweis Anhänge
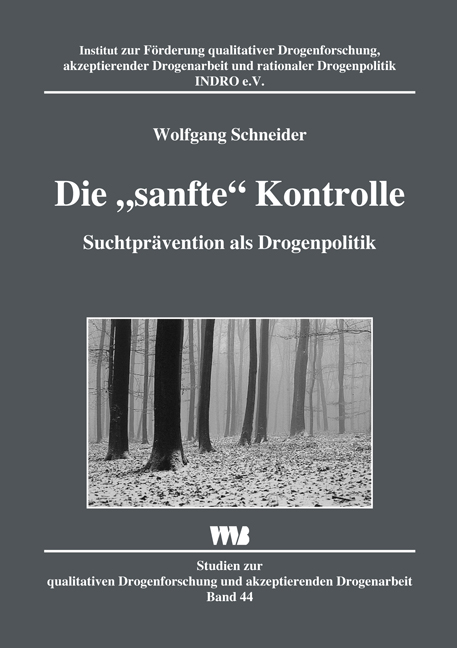
Die "sanfte" Kontrolle Suchtprävention als Drogenpolitik Schneider, Wolfgang (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 44) 2006 96 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 15,00 ISBN-13 978-3-86135-256-3 Suchtprävention richtet sich meist nicht an das, was Jugendliche und junge Erwachsene aktuell tun, sondern was sie tun könnten. Insofern wird "der" mögliche Drogenkonsument zum Objekt der Begierde fürsorglicher Präventionsanstrengungen und "sanfter" Kontrollstrategien vor einem häufig drameninszeniernden Hintergrund diffuser Gefahren- und Bedrohlichkeitsannahmen ("Die Seuche Cannabis"). Dabei ist gegenwärtig in der Suchtprävention ein Hang zu "Lösungstechnologien" festzustellen und die Beherrschbarkeit sozialer Risiken wird suggeriert. Wenn nur so früh wie möglich interveniert wird, dann wäre der Gebrauch psychoaktiv wirksamer Substanzen vermeidbar. Der Autor des 44. Bandes in der Reihe Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, herausgegeben von Indro e.V., rekonstruiert kritisch und teilweise auch provokativ die unterschiedlichen Formen suchtpräventiver Zugriffsweisen als "funktional-symbolische" Drogenpolitik. Suchtprävention und Drogenhilfe müssen sich auch aus Legitimationsgründen auf eine Problem-, Defizit- und Risikoblickrichtung "zielgruppenbezogen", "früherkennend" und "frühintervenierend" orientieren. Ihre Funktion ist dabei, das medial und somit auch "moralisch" hochstilisierte jugendliche Drogenproblem "erträglich" zu gestalten und die Öffentlichkeit durch symbolisch vermittelte Sinngebungen zu beruhigen, Abschließend wird ein realitätsgerechtes Konzept einer akzeptanzorientierten Verbraucherbegleitung im Sinne der moderierenden Unterstützung einer "genussfähigen Drogengebrauchskompetenz" entworfen und in den Kontext einer kritischen Aufarbeitung funktionaler Drogenpolitik und Drogenhilfe gestellt. Inhalt: 1. Das suchtpräventive Paradoxon 2. Wie Drogenprobleme und präventive Zugriffsweisen "gemacht" werden 3. Problemwahrnehmung, Problemthematisierung, Problembearbeitung: Eine "Entwicklungsgeschichte" 4. Alte und neue Drogenmythen 5. Suchtprävention als Sedativum 6. Pädagogische Problem- und Risikokontrolle 7. Genussfähige Gebrauchskompetenz 8. Zukunftsperspektiven von Suchtprävention und Drogenhilfe Literaturverzeichnis
